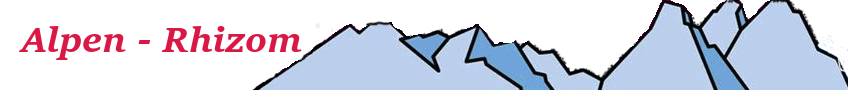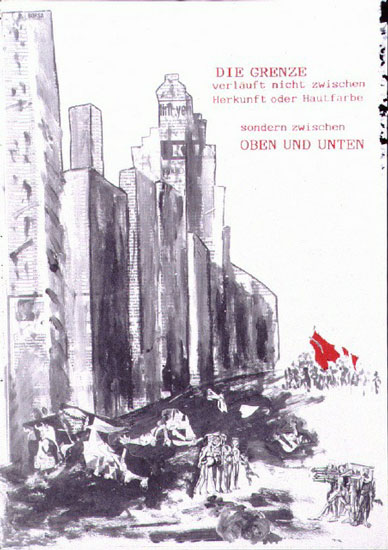Herzensangelegenheiten
Im letzten Jahr (2022) erschien im Verlag Assoziation A das Buch „Herzschläge“, das ein Gespräch mit Ex-Militanten der Revolutionären Zellen zur Geschichte und Politik dieser Gruppe dokumentiert. Wir haben das Buch mit Interesse und Begeisterung gelesen, vor allem, weil die drei nicht mehr ganz jungen Ex-Militanten der RZ mit Offenheit über ihre Motive, Hoffnungen, Widersprüche und Enttäuschungen gesprochen haben. Diese subjektive Sicht auf ihre Geschichte wird bei den noch lebenden Weggefährt*innen bestimmt nicht auf ungeteilte Zustimmung gestoßen sein. Uns hat der Band aber sehr inspiriert, über unsere eigene Praxis nachzudenken, gemeinsam zu diskutieren, die Ergebnisse festzuhalten und auf diese Weise zu veröffentlichen.
Wir sind eine Gruppe von Menschen, die alle aus der linksradikalen, autonomen Bewegung kommen und einen sagen wir mal „positiven Bezug zu militanter Praxis“ haben. Uns eint die ungebrochene Sehnsucht, theoretische und praktische Ansätze und Perspektiven der Befreiung und der Umwälzung der bestehenden Verhältnisse trotz der nicht gerade ermutigenden Aussichten zu suchen, zu diskutieren und zu erproben.
Es gibt einige Gründe, warum für uns die Praxis der Revolutionären Zellen und der Roten Zora bis heute ein wichtiger Bezugspunkt ist. Zunächst nur stichwortartig: die Bewegungsorientierung der RZ und der Roten Zora auf die Frauenbewegung, die Anti AKW Bewegung, die Häuserkämpfe, oder die Bewegung gegen die Startbahn West des Frankfurter Flughafens die Aktionen gegen Sex-Shops, Gen- und Reproduktionstechnologien und nicht zuletzt die Kampagne „Für freies Fluten“ gegen Abschiebebehörden. Außerdem ihre undogmatische Haltung, ihre vermittelbaren Aktionen, und dass sie im Gegensatz zur RAF nicht militaristisch und erstaunlich erneuerungsfähig waren.
Die RAF hatte ab Anfang der 80er Jahre durch die Hungerstreiks der Gefangenen und spektakuläre, zuweilen tödliche Angriffe auf Politiker, Militärs, Vertreter der Justiz und Wirtschaftsbosse eine sehr viel stärkere Resonanz in der Öffentlichkeit. Sie polarisierte und zwang viele Linke, sich zu positionieren. Im Gegensatz zur RAF, sahen die RZ die Illegalität aber nicht als befreites Gebiet, sie handelten nach der Devise, „wie ein Fisch im Wasser“ in der Bewegung aktiv zu sein und so lange wie möglich unterhalb des polizeilichen Radars zu bleiben, um handlungsfähig zu sein. Das schien lange ein kluges Konzept zu sein, es stieß allerdings immer dann an seine Grenzen, wenn Polizei und Justiz den Fahndungsdruck erhöhten. Die Praxis der RZ, Brand- und Sprengstoffanschläge auf Wohnungskonzerne, Industrieunternehmen, Forschungseinrichtungen, Energie- und Rüstungskonzerne durchzuführen entsprach viel eher der Praxis der autonomen und undogmatischen Linken, die in den 70er und 80er Jahren zu größeren Mobilisierungen fähig war. Dabei trafen die Parolen der RZ wie JEDES HERZ IST EINE ZEITBOMBE oder BILDET BANDEN bei undogmatischen Linksradikalen den Nerv der Zeit und entsprechende Plakate hingen fast in jeder ihrer WGs.
Als sich die RZ Anfang bis Mitte der 1990er Jahre auflösten und durch die veröffentlichten Papiere große Differenzen und Brüche innerhalb der RZ sichtbar wurden, war das Erstaunen in der autonomen Linken groß, schließlich begriffen viele die militante Kampagne „Für Freies Fluten“ und ein uneingeschränktes Aufenthaltsrecht für Geflüchtete auch als inhaltlichen Rahmen und praktischen Ansatz, um die rassistischen Pogrome von Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda und die parlamentarischen Angriffe auf das Asylrecht politisch zu beantworten.
Der Band „Herzschläge“ liefert einige interessante Antworten auf unsere Fragen an die RZ, bleibt bei der Frage, was aktuell zu tun ist sehr vage, gibt aber auch ein paar erstaunliche Hinweise auf die Anfänge der RZ und deren Zusammenarbeit mit der Black Panther Party in Westdeutschland und Berlin Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre, was eine Erklärung dafür liefert, warum die RZ sich in ihrer über zwei Jahrzehnte währenden militanten Geschichte immer wieder mit Feuer und Flamme auf die Kämpfe gegen Rassismus, Apartheid und gegen Abschiebungen bezogen. Diese antirassistische Praxis der RZ und die Anschläge der Roten Zora auf die Textilkette ADLER zur Unterstützung eines Frauenstreiks in Südkorea sind für uns bis heute beispielhafte militante Interventionen.
Nun könnte dieser Beitrag an dieser Stelle auch schon wieder enden: Da haben sich Menschen die Mühe gemacht, ihre politische Geschichte noch einmal zu besprechen und wir haben es wohlwollend zur Kenntnis genommen. Gelesen, geliked, positive Rezension verfasst. Punkt.
Aber zum einen haben wir durchaus auch zur Kenntnis genommen, dass das „Herzschläge“-Gespräch nicht einfach nur ein Geschichtsbuch sein möchte, zum andern würde unser Beitrag der Sache nicht gerecht. Welcher Sache? Die Ernsthaftigkeit, mit der im Gespräch versucht wurde, auch die Aspekte der eigenen Geschichte zu erwägen, die nicht ganz so rund waren und die schmerzhaften Erfahrungen, Zweifel und selbstkritischen Überlegungen offenzulegen.
Was wir an der Geschichte der RZ ablesen können, ist, dass sich dort Menschen darum bemüht haben, eine an die eigenen Möglichkeiten und die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Zeit angepasste Antwort auf die Frage zu finden, was der eigene Beitrag dazu sein kann, die zutiefst ungerechte, ausbeuterische, kapitalistische Weltordnung im Ganzen und deren Ausdrucksformen hier infrage zu stellen und anzugreifen. Und worin wir eine besondere Qualität erkennen, ist die Fähigkeit und Bereitschaft der RZ, dabei auch neue Wege zu suchen und zu beschreiten, wenn sich die bis dahin praktizierten Konzepte als überlebt oder als Sackgasse erwiesen hatten.
Anders und kurz gesagt: Das Lesen des Buches hat bei uns zu vielfältigen, langen und für uns anregenden Diskussionen geführt. In diesem Beitrag wollen wir ein paar Themen dieser Diskussionen aufgreifen, zusammenfassen und mit der Hoffnung veröffentlichen, dass andere sich zu einer Erwiderung angeregt fühlen. Es geht im Folgenden vor allem um die Frage, was für uns revolutionäre Politik heute bedeuten könnte, warum eine revolutionäre Praxis dringlicher denn je ist und warum es so schwierig ist, sie zu entwickeln. Das ist aber nur ein Aspekt der Themen und Fragen, die wir diskutiert haben, und es soll auch kein abgeschlossener Text sein, sondern eine Anregung, über die Perspektiven linksradikaler Praxis ins Gespräch und in Bewegung zu kommen.
I. BESTANDSAUFNAHME
„Was ist, wenn alles scheiße ist?…“
Stichworte zu den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für revolutionäre Politik heute
Im Vergleich mit den 1970er, 80er und 90er Jahren haben wir es heute mit wesentlich veränderten politischen Rahmenbedingungen für eine revolutionäre Politik im globalen Norden zu tun. Dazu gehören aus unserer Sicht der Zusammenbruch des sogenannten Blocks der sozialistischen Länder und der damals existierenden globalen Bipolarität. Nach dem Ende des sogenannten Ost-Westkonflikts haben wir eine Phase gewaltsamer Akkumulation in den Ländern und Einflussregionen des ehemaligen „real-sozialistischen Blocks“ und eine Neuorganisation der ökonomischen Beziehungen unter der Dominanz neoliberaler Verwertungsmodelle erlebt, die unter anderem in der sogenannten Finanz- und Staatsschuldenkrise 2008 kulminierte. Parallel dazu wurde die Phase revolutionärer/antikolonialer (nationaler) Befreiungskriege der 1950er bis 1980er Jahre im globalen Süden durch lokale oder regionale Revolten und Bürgerkriege abgelöst.
Die Entwicklung der Produktivkräfte hat durch die technischen Umwälzungen im IT-Bereich ein Niveau erreicht, an dem in vielen Sektoren der Produktion, der Distribution und Reproduktion menschliche Arbeitskraft entbehrlich oder ersetzbar geworden ist, ohne dass dadurch das kapitalistische System zusammenbrechen würde und auch ohne dass dadurch massenhaft Menschen vom Zwang zur Lohnarbeit befreit wären. Im Gegenteil: immer mehr Menschen arbeiten und leben in prekären Verhältnissen und der technische Fortschritt, die kapitalistische Produktion und der globale Konsum verschlingen immer schneller immer mehr natürliche Ressourcen.
Immer mehr Menschen aus dem globalen Süden suchen im Norden eine Perspektive. Einige, weil sie vor Kriegen oder Bürgerkriegen fliehen oder diktatorischen Regimen entkommen wollen, die ihnen keine Luft zum Atmen lassen. Andere, weil sie in ihren Ländern die grausamen Auswirkungen des globalen Kapitalismus zu spüren bekommen, sei es, weil natürliche Lebensgrundlagen unwiederbringlich zerstört werden um gefragte Rohstoffe gewinnbringend ab- oder anzubauen, sei es, weil die durch den Weltmarkt für sie vorgesehenen Lebens- und Arbeitsbedingungen unerträglich sind, sei es, weil die Klimakrise zu Hungersnöten und Überschwemmungen führt. Die Länder des globalen Nordens reagieren mit dem Bau von militärisch gesicherten Grenzen und Lagern. So sind für Zigtausende Menschen Meere, Wüsten und Grenzflüsse zu Zonen der Rechtlosigkeit, Gewalt und des Todes geworden.
An der Klimakrise wird deutlich, dass seit Jahrhunderten der Wohlstand, die Sicherheit und die Privilegien weniger auf dem Leid und der Unterdrückung und Ausbeutung einer Mehrheit der Weltbevölkerung beruhen. Aber anders als in Zeiten der kolonialen Unterwerfung der Welt lassen sich die Folgen der unbeschränkten Ausbeutung menschlicher und natürlicher Ressourcen inzwischen nicht mehr komplett aus den Wohlstandsoasen der reichen Industriestaaten auslagern. Der Umstand, dass auch in Ländern wie Deutschland die Auswirkungen der globalen Erwärmung unmittelbar zu spüren sind, führt bisher aber nicht dazu, dass das System, das dafür verantwortlich ist, von „der Masse“ hier infrage gestellt würde. Stattdessen sehen wir, dass die Aufrüstung der europäischen Grenzen und die gewaltsame Abwehr derjenigen weiter eskaliert, die weltweit auf der Flucht aus Hunger, Elend und Krieg sind. Sie sollen den Preis für ein paar weitere Jahre oder Jahrzehnte ungehinderter kapitalistischer Ausbeutung und Zerstörung bezahlen, in denen sich die privilegierten Menschen im globalen Norden vormachen können, es wäre ja alles gar nicht so schlimm und wenigstens der eigene relative Wohlstand noch zu retten.
Rassistische Denkweisen und rassistische Migrationspolitiken in den europäischen Staaten sind nicht neu. Aus einer deutschen Perspektive hat sich seit der sogenannten Wiedervereinigung 1990 das Problem aber insofern verschärft, als dass der Nationalismus wieder salonfähig wurde. Spätestens seit der Asyldebatte der 1990er Jahre haben sich offen rassistische Diskurse in der sogenannten Mitte der Gesellschaft festgesetzt und tragen mit dazu bei, dass die globale Ordnung auch in der hiesigen Gesellschaft wirksam bleibt. Alle, die nicht dazugehören dürfen, sollen dankbar sein, die dreckigsten Jobs unter prekärsten Bedingungen zu machen. Auch die sogenannten Hartz-Reformen haben eine wichtige Rolle dabei gespielt, neben und verbunden mit der rassistischen Spaltung auch die soziale Spaltung weiter zu vertiefen. Die Drohung mit sozialer Deklassierung, die offene Verachtung, die Menschen in Armut entgegengebracht wird, die repressiven Eingriffe in die Lebensgestaltung von Menschen im ALG-2-Bezug, haben die Mischung aus Neid und Angst, die den Individuen im Kapitalismus als psychische Grundstruktur eingetrichtert wird, bei vielen Menschen der „Mittelschicht“ noch sichtbarer gemacht. Diese Politik ist allerdings keine deutsche Erfindung, sie ist Teil der neoliberalen Politik, in der die letzten Reste sozialer Garantien und Absicherungen zerstört werden. Als ironische Konsequenz aus all diesen demokratisch legitimierten Ausschlüssen und Bruchlinien ernten derzeit Populist*innen, Autoritäre und Faschist*innen die Früchte. In Europa, in den USA und anderen Ländern des globalen Nordens gewinnen autoritäre Regulation, Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus an Bedeutung. Faschist*innen werden in Parlamente gewählt, sie sitzen im Sicherheitsapparaten, in der Justiz und in Regierungen oder dominieren sie sogar.
Zu der allgemeinen Akzeptanz gegenüber repressiven und militärischen Lösungen sozialer Probleme passt, dass die seit langem forcierte Militarisierung der europäischen Gesellschaften inzwischen sehr weit fortgeschritten ist. Und seit dem Ukraine-Krieg können wir auch noch eine Renaissance der Nato beobachten und müssen fassungslos zur Kenntnis nehmen, dass viele Linke auf einmal anfangen, Vertrauen in dieses imperiale Militärbündnis zu setzen und Waffenlieferungen in Kriegsgebiete als notwendig zu betrachten. Wir erleben seit einigen Jahren eine starke Militarisierung regionaler politischer Konflikte und den Übergang zur direkten militärischen Konfrontation in der Austragung inner-imperialistischer Widersprüche zwischen den USA, Europa, Russland und China. In weiten Teilen der Erde ist Krieg zum Dauerzustand geworden: In vielen Ländern der Subsahararegion und im Maghreb, in Israel/Palästina, Syrien, Kurdistan, Irak, Afghanistan, der Kaukasusregion, Osteuropa,… Überall auf der Welt gewinnen Bewegungen des bewaffneten religiösen Fundamentalismus an Bedeutung und sind wesentlicher Faktor in sozialen Kämpfen und in den militärischen Konfrontationen vor allem im globalen Süden geworden.
Das ist die eine Seite, sie ist ziemlich düster und beschreibt aus unserer Sicht, was sich an den politischen Rahmenbedingungen für revolutionäre Politik im Vergleich zu den 1970er Jahren verändert hat. Aber trotz und vielleicht auch teilweise gerade wegen all dem, was wir eben angerissen haben, gibt es immer noch und immer wieder Menschen, die sich mit all dem nicht abfinden wollen. Und es gibt sie überall. Im globalen Süden und im Norden entstehen immer wieder Bewegungen und brechen Revolten und Aufstände aus, die die herrschende Ordnung grundsätzlich in Frage stellen, sei es im Mittelmeerraum und im Mittleren Osten (Tunesien 2009 bis Teheran 2022/23), Lateinamerika (Argentinien 2008, Chile 2018/2019), Afrika (Südafrika 2018, Sudan 2021), in Europa (Griechenland 2008, Frankreich 2016/2023) oder in den USA (2020). Diese Liste ist nur ein kleiner Ausschnitt und die Jahreszahlen sollen nicht den Eindruck erwecken, als wären diese Aufstände, Revolten und Brüche auf genau diese historischen Zeitpunkte beschränkt. Wir sehen in diesen Revolten und in den Bewegungen, die sie tragen, Momente von Emanzipation aufscheinen. Wir fühlen uns verbunden mit den Menschen auf der Straße. Wir fühlen ihre Wut, wenn die Reaktion zum Gegenschlag ausholt, oftmals ausgestattet mit Tränengasgranaten und Maschinenpistolen aus deutscher Produktion und wir sehen auch, dass die Sehnsucht nach einem anderen, besseren und guten Leben für alle Menschen weder mit Polizeiknüppeln noch mit Panzerketten zerstört werden kann.
In unserer Auseinandersetzung mit dem „Herzschläge“-Buch haben wir vor dem oben beschriebenen Hintergrund diskutiert, wie heute eine sozialrevolutionäre, internationalistische Politik aussehen muss. Das wollen wir im Folgenden darstellen. Was wir aus der Geschichte linker Bewegungen für unsere Auseinandersetzung mit den eigenen Verstrickungen in antisemitische, rassistische und sexistische Strukturen lernen können, dazu haben wir bisher leider nur unzureichende Antworten gefunden.
II. POSITIONSBESTIMMUNG
„… Dann sind wir eben gegen alles!“
Revolutionäre Politik, wenn keine Revolution in Sicht ist: Was ist heute sozialrevolutionäre, internationalistische Politik und welche Rolle spielt der Staat?
Neben den politischen Rahmenbedingungen haben sich offensichtlich auch unsere Sprache und die Begriffe, mit denen wir die gesellschaftlichen Unterdrückungsverhältnisse beschreiben und unseren Kampf zu bestimmen versuchen, im Vergleich zu den 1970er Jahren geändert. Manche Begriffe erscheinen uns von den Verhältnissen überholt, zum Beispiel bewaffnete Politik, andere waren zwischenzeitlich aus manchen linksradikalen Diskursen verschwunden und erleben gerade wieder eine Renaissance wie sozialrevolutionär oder antiimperialistisch. Die Frage, was eigentlich sozialrevolutionäre Politik ausmacht und wie sie praktisch umgesetzt werden kann, zieht sich insgesamt durch das ganze „Herzschläge“-Buch und vermischt sich manchmal mit der Frage, was genau das spezifische am Ansatz der Revolutionären Zellen gewesen ist.
Sozialrevolutionär und mehr noch antiimperialistisch sind Begriffe, mit denen wir uns heute schwer tun, allein schon weil sie inzwischen eher als Label funktionieren anstatt wirklich mit Inhalt gefüllt zu werden. Allerdings sind uns für die Bestimmung unserer politischen Aktionen sowohl der Bezug auf lokale soziale Kämpfe, wie auch der Versuch, internationalistische Perspektiven und Kämpfe des globalen Südens einzubeziehen, unverzichtbar, auch wenn wir die traditionellen Begriffe selten verwenden. Ein nicht zu vernachlässigender Unterschied zu den RZ der 1970er und 1980er besteht wahrscheinlich in der Frage der konkreten organisatorischen und politischen Verbindungen mit Organisationen und Bewegungen des globalen Südens. Bevor wir aber diesen letzten Punkt wieder aufgreifen, wollen wir nach den Inhalten einer emanzipatorischen und vielleicht sogar revolutionären Politik heute fragen und die Anstöße benennen, die wir dafür bei unserer Lektüre der „Herzschläge“ bekommen haben.
In der Bestandsaufnahme und den Rahmenbedingungen, die wir im ersten Abschnitt skizziert haben, haben wir versucht zu beschreiben, dass das soziale Elend in dem viele Menschen leben und die globale Dimension der Verhältnisse, die dieses Elend hervorbringen, nicht voneinander getrennt werden können. Wenn wir die alten Begriffe dafür nutzen wollen Schlussfolgerungen zu ziehen, dann hieße das, dass sozialrevolutionäre Politik immer internationalistisch gedacht und in diesem Sinne Antworten für die politische Praxis gefunden werden müssten. Es kann nicht darum gehen, in den europäischen Gesellschaften dafür zu kämpfen, die Privilegien, die die Europäer*innen einer ausbeuterischen und menschenverachtenden Weltordnung verdanken, aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig müssen wir aber praktische Vorschläge machen, wie das soziale und psychische Elend, dem auch in Europa Millionen von Menschen ausgesetzt werden, durchbrochen und beendet werden kann.
Und damit wären wir dann auch bei einem anderen Begriff und Gedanken, der sich als roter Faden in der ganzen Geschichte der radikalen Linken wiederfindet: der Revolution. Aus unserer rudimentären Analyse ergibt sich, dass der Zustand der Welt nach radikalen, revolutionären Umbrüchen in allen Bereichen, politisch, ökonomisch, sozial und kulturell, schreit und uns gleichzeitig die dafür noch verbleibende Zeit durch die Finger rinnt. Die politische Wirklichkeit, mit der wir uns in Europa herumschlagen, weist aber momentan in eine ganz andere Richtung: die zunehmend autoritäre Aufrechterhaltung und Durchsetzung gesellschaftlicher Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse. Wenn wir als Militante einerseits keine konkrete Vorstellung davon entwickeln können, wie wir dazu beitragen können, „alle Verhältnisse umzustoßen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“, andererseits aber zutiefst davon überzeugt sind, dass genau das passieren muss, wenn es irgendwann doch noch einmal besser werden soll, dann müssen wir uns fragen, wie wir mit unserer Politik wenigstens die Notwendigkeit und den Gedanken einer Revolution verdeutlichen und anderen Menschen vermitteln können.
Es mag nicht viel sein, was uns zum jetzigen Zeitpunkt dazu einfällt, aber wir wollen es trotzdem zur Diskussion stellen, auch weil wir hoffen, dass es auf Dauer doch klappen könnte, gemeinsam in Theorie und Praxis etwas mehr Licht am Horizont zu finden. Wir haben in unserer Auseinandersetzung mit dem „Herzschläge“-Buch länger darüber diskutiert, welchen Stellenwert wir hierbei militanter Praxis, klandestiner Organisierung, der Frage von Vernetzungen und der Weitergabe von praktischem Wissen und dem Bemühen um Kontinuität in Kämpfen beimessen. Als entscheidender an dieser Stelle erschien uns allerdings ein ganz anderer Punkt, auf den wir uns deshalb auch beschränken wollen: Um überhaupt die Chance zu bekommen, eine revolutionäre Perspektive zurückzugewinnen, braucht es unserer bescheidenen Meinung nach vor allem inhaltlicher Klarheit. Klarheit darüber, warum revolutionäre Prozesse und Versuche, die Grundlagen des sozialen, ökonomischen, politischen Miteinanders neu zu denken, dringlich sind – und letztlich die einzig sinnvolle und menschenwürdige Alternative sind, um das Problem der Ungerechtigkeit, der Unterdrückung, der Ausbeutung, der vielfältigen Gesichter von Herrschaft und ihren Zusammenhang mit den gesellschaftlichen und politischen Grundstrukturen der Gegenwart anzugehen.
Wir denken es ist notwendig, die Diskussionen und Einsichten der vergangenen Jahrzehnte, die unterschiedliche Erscheinungsformen von Unterdrückung und Herrschaft betreffen, ernst zu nehmen und zusammenzubringen. Hier müssen wir offener und selbstkritischer werden und auch dabei ist es wichtig und hilfreich, von anderen zu lernen und es sich im eigenen militanten Dunstkreis nicht zu gemütlich zu machen. Revolution ist kein Zweck, sondern ein Mittel zur Veränderung, zur Befreiung von dem, was Menschen unglücklich macht, deformiert, in ihren Wünschen und Bedürfnissen beschneidet, ihre Freiheit beschränkt, ihre Würde verletzt. Wir dürfen nicht den Fehler machen, den Traum von einer Revolution wie einen linken Fetisch zu pflegen und zu hegen, sondern wir müssen uns fragen, warum und wofür überhaupt eine solche Revolution nötig und nützlich sein soll.
So selbstverständlich das vielleicht klingt, so klippenreich und manchmal auch widersprüchlich ist das dann aber doch in der politischen Praxis. Wir haben länger über zwei im Buch angesprochene Themen geredet, die vielleicht verdeutlichen, was wir meinen. Zum einen waren das die Probleme, vor denen die damals Aktiven der RZ standen, als die Forderung nach „Feminisierung“ der eigenen Politik und Praxis im Raum stand. Es wird beim Lesen deutlich, dass die Auseinandersetzung darüber viel Ratlosigkeit produziert hat. Das andere Thema ist das eigene Verhältnis zum Antisemitismus und die davon letztlich nicht zu trennende Position zum Staat Israel.
Bei beiden Themen hat sich seit der Zeit, in der die RZ aktiv waren, manches getan, es wurden Klärungen versucht – und auch wieder verloren. Es zeigt sich immer wieder in der linken Geschichte, dass es auf dem Papier einfach ist, sich zu einem umfassenden Verständnis von Kritik zu bekennen, das Herrschaft in all ihren Facetten und Formen erkennt und überwinden will. Es zeigt sich ebenso in der Geschichte der Linken, dass auch in unseren Reihen und Kreisen immer wieder Roll-Backs, Entsolidarisierung, die Preisgabe emanzipativer Überzeugungen und Übereinkünfte stattfinden. Es ist leicht, sich als antipatriarchal zu bezeichnen, es ist schwerer, das mit Inhalten zu füllen und zum Beispiel auch dann zu leben, wenn es um persönliche Verstrickungen, vermeintlich wichtigere politische Interessen usw. geht. Und von einer wirklich mit Inhalten gefüllten Idee, wie eine antipatriarchale, antisexistische radikale Praxis in gemischten Szenen aussieht, welche Ziele sie verfolgt, wo sie ansetzen kann um wirksam zu werden, sind wir auch Jahrzehnte, nachdem die RZ ratlos vor dieser Leerstelle standen, immer noch ziemlich weit entfernt.
Wir beenden die Bearbeitung dieses Textes in den Tagen und Wochen, in denen in Israel ein Krieg tobt. Ausgelöst durch das grauenerregende Massaker der Hamas am 7. Oktober, das uns fassungslos gemacht hat. Es sind auch Tage und Wochen, in denen an etlichen Orten weltweit jüdische Menschen durch antisemitische Aggressionen und gewalttätige Übergriffe bedroht werden. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, denn auch wir treten nichts Praktisches los, das ansatzweise in der Lage wäre, sich solidarisch gegen die antisemitische Mobstimmung zu stellen.
Wir steigen jetzt dazu in diesem Text nicht tiefer ein, denn wir bräuchten noch mehr Zeit und Diskussionen, um inhaltlich etwas beizutragen, dass der Sache gerecht wird. Aber worum es uns an dieser Stelle geht ist Folgendes: Wenn wir eine Idee von Befreiung entwickeln wollen, die auch wirkliche, und das heißt umfassende Befreiung meint, dann dürfen wir keine feinen Unterschiede in unserer radikalen Kritik aller Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse einführen. Wir müssen Rassismus so ernst nehmen wie das Patriarchat, globale kapitalistische Ausbeutungsstrukturen ebenso bekämpfen wie den Antisemitismus, wo und wie immer er sich zeigt. Und wir dürfen nicht anfangen, aus vielleicht gut gemeinter Solidarität mit den einen, andere Gesichter der Herrschaft zu ignorieren oder sogar zu negieren, weil sich vielleicht Widersprüche oder Konflikte auftun. Was wir aber tun müssten, ist solchen Widersprüchen und Konflikten nachzugehen, zu analysieren, wo wir sie auflösen können und wo wir sie vielleicht auch erst einmal aushalten und stehen lassen müssen. Das wäre für uns eine Vorbedingung dafür, uns tatsächlich eine Vorstellung davon neu zu erarbeiten, was wir als revolutionär begreifen.
Was bedeutet für uns sozialrevolutionär?
Zunächst meinen wir damit ganz klassisch militante Intervention in lokale und regionale Kämpfe um bessere Lebensbedingungen: Wohnen, Arbeit, Gesundheit, Bildung,… Diese Kämpfe bringen oft die Schwierigkeit mit sich, dass es um sehr konkrete Forderungen und unmittelbare Problemlagen geht, für die Abhilfe geschaffen werden muss (gefälschte Fahrscheine, Kampagnen für Vergesellschaftung von Wohnraum, Bewegungsfreiheit und Aufenthaltsrecht für Migrant*innen, Widerstand gegen Atomtransporte oder Kohletagebau,…). Oft stagnieren solche Kämpfe nach der Durchsetzung kleiner Erfolge oder sie werden befriedet und instrumentalisiert. Häufig scheitern sie und manchmal führen sie zu Reformen, die aber nur beschränkte Effekte haben. „Revolutionären Charakter“ können solche Kämpfe bekommen, wenn sie mit Prozessen von gesellschaftlicher Selbstorganisierung verbunden sind, wenn sie konkrete Veränderungen gegen die herrschenden Verhältnisse durchsetzen, wenn sie deren Spielregeln durchbrechen und sichtbar machen, dass es auch anders gehen kann – wenn sie dazu führen, dass immer mehr Menschen verstehen: es gibt Lösungen, aber nicht innerhalb der bestehenden Verhältnisse.
Militante Praxis ist in diesem Kontext nicht per se revolutionär. Aber wenn durch militante Aktionen die den Auseinandersetzungen zugrundeliegenden gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse sichtbar gemacht und angegriffen werden, eröffnet militante Praxis die Möglichkeit, das sozialrevolutionäre Moment dieser Kämpfe zu stärken. Ob es dazu kommt, hängt dann aber auch an der gesamten Bewegung und erfüllt sich erst, wenn wirklich gesellschaftliche Machtverhältnisse ins Wanken geraten.
Ein Punkt, der uns in Diskussionen über (sozial)revolutionäre Perspektiven immer wieder begegnet, ist: es gibt zu wenig klare Vorstellungen davon, wie eine befreite Welt und Gesellschaft aussehen und wie das Leben und Zusammenleben dort organisiert werden könnte. Früher sei das anders gewesen und das habe Leute mobilisiert und Kämpfe dynamischer gemacht. Wir befürchten, dass es nicht möglich ist, ein so verheißungsvolles Panorama zu entwerfen. So banal es klingt, wir sind davon überzeugt, dass die Vorstellung von einer befreiten Gesellschaft im Wesentlichen im Prozess der Befreiung selbst entwickelt werden muss. Und dass das ein langwieriger Prozess mit vielen Klippen und auch Rückschlägen sein wird. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass es zuerst eine Utopie oder ein konkretes Konzept eines irdischen Paradieses geben muss, damit viele Menschen sich begeistert für eine Revolution organisieren und auf der Straße treffen. Eine Revolution bricht aus, wenn sich allgemein zu viel Hass und Wut angestaut hat, die sich durch Repression und staatliche Gewalt nicht mehr unterdrücken lässt. Ideen und Konzepte für ein irdisches Paradies sind aber trotzdem wichtig, um zu versuchen, einer Revolution dann auch eine tatsächlich emanzipatorische Richtung zu geben. Und sie lassen sich auch bereits jetzt im Kleinen erproben und entwickeln.
Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist uns klar, dass jede kommende Revolution für viele Menschen im globalen Norden (auch für viele „von uns“) darauf hinsteuern muss, Privilegien aufzugeben. Fernreisen zwei- oder dreimal im Jahr mit dem Flugzeug, Privatautos in der Garage, die Hütte voll mit Elektrogeräten, das wird es nicht mehr geben, wenn wir wollen, dass wirklich alle Menschen menschenwürdig leben können. Und das wird noch deutlicher, wenn wir, wie oben schon mal angedeutet, ernst nehmen, dass sozialrevolutionär und internationalistisch zusammen gedacht werden müssen. Die privilegierte „imperiale Lebensweise“ des globalen Nordens ist das Ergebnis von Jahrhunderten einer ausbeuterischen, rassistischen und zutiefst ungerechten politischen und wirtschaftlichen Weltordnung. Wer nur dafür kämpft, dass im globalen Norden der Reichtum gerechter verteilt wird, wird weiter für das Leid unzähliger anderer Menschen unmittelbar verantwortlich bleiben. Das ist nicht die Befreiung, die wir meinen. Und wenn wir nicht die Augen davor verschließen können und wollen, dass die kapitalistischen Begehrlichkeiten nach immer mehr Ressourcen und die ganze Art und Weise, wie heute produziert und gelebt wird, auf dem besten Wege sind, die Chancen auf gutes und irgendwann überhaupt auf Leben auf diesem Planeten zu zerstören, dann liegt das Problem auf der Hand. (Ein anderes Kapitel wäre, dass die Klimaveränderung zwar alle, aber wie immer nicht alle gleichermaßen trifft. Das vertiefen wir hier jetzt mal nicht, was das bedeutet, ist ja auch ziemlich klar.)
Internationalistische Perspektiven neu entwickeln
Im Buch werden die internationalen Verbindungen der RZ zu anderen bewaffneten Organisationen und Befreiungsbewegungen diskutiert und deren Konsequenzen problematisiert. Wenn wir es uns leicht machen wollten, könnten wir sagen: diese Verbindungen und die damit einhergehenden Probleme gibt es doch sowieso nicht mehr – Problem erledigt. Doch das wäre zu einfach, denn wie schon gesagt, ohne eine Verbindung unserer politischen Praxis hier mit Kämpfen in anderen Ländern und anderen Kontinenten wird es keine globale Befreiung geben. Alles unterhalb einer globalen Befreiung wird aber nicht funktionieren. Es gibt keine Perspektive einer regionalen Befreiung, egal ob es um patriarchale und sexistische Zurichtung, kapitalistische Ausbeutung, rassistische Unterdrückung, oder die Beendigung antisemitischen Terrors geht. Das bedeutet, dass wir internationalistische Bezüge und Verbindungen zu Kämpfenden in anderen Ländern und Kontinenten (neu) herstellen und aufbauen müssen.
Dass wir nicht an alte Verbindungen und an gemeinsame Erfahrungen von Zusammenarbeit anknüpfen können, wie die im „Herzschläge“-Buch beschriebenen, ist zwiespältig. Einerseits sind internationale Verbindungen und Austausch unverzichtbar für eine revolutionäre Perspektive, andererseits sind wir froh über klärende und kritische Debatten der letzten Jahrzehnte, die das Verhältnis von „Metropolen-Linken“ und den Kämpfen und deren Organisationsformen in anderen Weltregionen unter die Lupe genommen haben. Wir wollen nicht zurück in die 1970er Jahre, wir wollen keine Idealisierung von Ansätzen und Gruppierungen, die aus der Distanz vielleicht attraktiv wirken, sich bei näherer Betrachtung dann aber doch die Frage aufwerfen, ob mensch mit ihnen wirklich am selben Projekt von Befreiung arbeitet. Kritisch nachzufragen und uns kritisch hinterfragen zu lassen, Gemeinsamkeiten zu suchen, aber nicht einfach vorauszusetzen, nicht die Kämpfe anderer nahtlos zu unseren zu machen, sondern lieber danach zu suchen, was genau diese Kämpfe wirklich und realistisch verbindet und Unterschiede zu benennen – das ist es, was uns eher vorschwebt, wenn wir von internationalistischer Politik reden.
Es wird nicht überraschen, wenn wir an dieser Stelle sagen, dass wir keine Freund*innen von Parteien und militärischen Organisationen sind. Für uns sind das Instrumente zur Erlangung und Verteidigung von politischer Macht, die letztendlich immer irgendwann selbst einer Perspektive von Befreiung im Weg stehen und deshalb wieder beseitigt werden müssen. Eine politische Zusammenarbeit mit solchen Organisationen, auch wenn sie auf dem Papier ein fortschrittliches Programm haben, halten wir für höchst problematisch und die Erfahrungen aus der Geschichte belegen das immer wieder und sind auch in „Herzschläge“ nachzulesen. Organisationen, Parteien und vor allem militärische Strukturen folgen einer anderen Logik als eine Bewegung. Deswegen muss für uns internationalistische Politik und ein solidarischer Bezug zu Kämpfen in anderen Regionen auf dieser Welt von einer Bestimmung des eigenen politischen Verhältnisses zu den jeweiligen Kämpfen getragen sein, auch von persönlichen Bezügen. Wir denken, dass die jeweiligen Kämpfe und die Bewegungen, die sie tragen, umfassender und vielfältiger sind als einzelne Organisationen, Parteien oder militärische Strukturen. Damit eine politische Verbundenheit und gemeinsames solidarisches Kämpfen entstehen kann, müssen wir in der Lage sein und bleiben, uns gegenseitig zu kritisieren, zu hinterfragen und voneinander zu lernen.
Ein prominentes Beispiel aus der Geschichte der RZ, das für uns in diesem Kontext sehr anschaulich ist, sind die Aktionen der Roten Zora gegen den Textilkonzern ADLER in den 1980er Jahren. Während in Südkorea ADLER-Arbeiter*innen mit Streiks für bessere Arbeitsbedingungen kämpften, machten die Zoras hier mit Feuer und Flamme Druck und schafften nicht nur Öffentlichkeit, sondern halfen auch mit, ADLER zum Einknicken zu bringen. Ein nicht ganz so erfolgreiches, aber vielleicht ähnlich nachvollziehbares Beispiel aus der jüngeren Zeit ist die Kampagne gegen Kik und Co nach dem Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch 2013.
Wie halten wir es mit dem Staat?
Die Positionsbestimmung und die inhaltlichen Klärungen, wie wir eine zeitgemäße militante Praxis begreifen, wollen wir mit einem letzten Aspekt vorläufig abschließen, bei dem wir doch ein paar Unterschiede zu dem erkennen, was die Genoss*innen damals offenbar gedacht
haben: dem Kampf gegen den Staat.
Das Thema wird im Buch etwas lapidar im Kontext einer Auseinandersetzung mit der Politik der RAF und Gefangenenbefreiung abgehandelt. Verkürzt liest sich dieser Abschnitt ungefähr so: „Der Staat ist nicht der eigentliche Gegner, es geht darum, an die sozialen Kämpfe anzudocken.“ Uns geht es auch nicht darum, eine falsche Fixierung auf den Staat zu reproduzieren oder den Staat als Urheber aller Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse zu verstehen. Allerdings ist der Staat auch nicht einfach nur ein Ausschuss des Kapitals um günstige Ausbeutungsbedingungen herzustellen und aufrecht zu erhalten. In antirassistischen Kämpfen um Bewegungsfreiheit und in antimilitaristischen Kämpfen gegen Rüstung und Krieg sind staatliche Strukturen und Akteur*innen sehr wohl herausragende Adressen für militante Interventionen. Genauso wenn es um den Kampf gegen Repression oder Interventionen zur sozialen Frage geht.
Dabei ist der Kampf gegen staatliche Verbrechen in komplexe Widersprüche eingebettet. Bestimmte Errungenschaften der sozialen Absicherung sind für manche, zum Beispiel für Menschen mit Behinderung oder für Menschen, die auf Pflegeleistungen angewiesen sind, etwas existenziell Notwendiges. Eine umfassende Zerstörung staatlicher Strukturen kann nur in ihrem Interesse sein, wenn wir auch eine Vorstellung davon haben, wie wir eine für diese Menschen adäquate und verlässliche Alternative organisieren können. Können wir das? Im Moment sehen wir das noch nicht. Im Gegenteil, selbst in unseren eigenen Strukturen gibt es doch kaum Ansatzpunkte, wie wir solidarische Beziehungen untereinander aufbauen können. Natürlich werden Genoss*innen in Notlagen oft nicht allein gelassen. Aber es besteht doch ein Unterschied zwischen Unterstützung, die wir einander bieten, weil wir uns kennen, und einer funktionierenden Struktur, die Existenzen sichern und in extremen Lebenslagen Sicherheit geben kann. Und es besteht ein Unterschied zwischen einer Hilfe, die netterweise gewährt wird, und einer Idee davon, wie es organisiert werden kann, dass alle Menschen nicht nur irgendwie überleben können, sondern ihr Leben selbstbestimmt gestalten. Wenn es darum gehen soll, irgendwann auch konkreter sagen zu können, was in einer „befreiten Gesellschaft“ anders sein müsste als hier und heute, dann gehört für uns auch dazu, uns hier und heute solche Fragen zu stellen wie: Wie überwinden wir unsere gesellschaftliche Zurichtung, die auch uns nahelegt, uns, und im Umkehrschluss auch die anderen, als „eigenverantwortlich“ für unser Wohlergehen oder unser Unglück zu sehen? Wie können wir die Verinnerlichung der Konzepte von Konkurrenz und Vereinzelung überwinden und neue Formen solidarischen Zusammenlebens ausprobieren und gleichzeitig klarmachen, dass es dabei auch um gesellschaftliche Fragen und Probleme geht, die das bestehende System nicht lösen kann?
Weil alles immer beschissener wird…
Angesichts der wachsenden innerimperialistischen Konflikte und der weltweiten massiven Militarisierung der Gesellschaften, angesichts der Eskalationsspirale von antisemitischem Terror und Kriegseinsätzen in Israel/Palästina, angesichts des sich ankündigenden ökologischen Kollaps durch den globalen kapitalistischen Extraktivismus, angesichts einer lächerlich winzigen und oft sprach- und ratlosen radikalen Linken von der wir ein Teil sind, gibt es genug Gründe zum Verzweifeln und Resignieren. Am Ziel einer tatsächlich umfassenden Befreiung von Herrschaft, Ausbeutung und Unterdrückung festzuhalten mag vielen als naiv oder absurd erscheinen. Wir denken jedoch, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als für genau dieses Ziel immer weiter zu kämpfen. Trotz allem!
Wir haben oben beschrieben, mit welchen Kriterien und Aspekten wir dabei unsere Praxis zu bestimmen versuchen. Ob diese Herangehensweise hilfreich ist und wie weit wir damit kommen, muss die Zukunft zeigen. Anyway, wir sehen uns auf der Straße!
aus kontrapolis