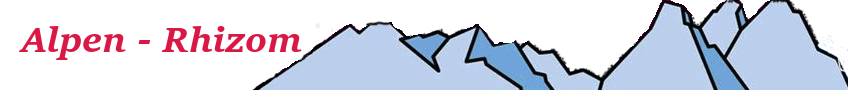Angst und Kapital
Warum Widerstand im Postfordismus so schwierig ist
Holger Heide
Einleitende Thesen
Nicht zufällig kennzeichnet viele der neuen widerständigen Bewegungen, dass sie mit dem ausdrücklichen Formulieren der eigenen Angst beginnen und so das Tabu der „Angst vor der Angst“ durchbrechen. Das kann eine haltbare Grundlage sein, statt abstrakter Interessen die wirklichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen.
In der langen Geschichte der Durchsetzung der Herrschaft des Kapitals hat sich menschliche Lebendigkeit als eine nicht vesiegende Triebkraft gegen ihre Vereinnahmung erwiesen. Und dennoch kann die Geschichte der sozialen Bewegungen als eine Geschichte der Niederlagen erscheinen. Die sozialen Bewegungen haben sich bisher trotz der vorübergehend "großen Siege" offenbar nicht wirklich vom Kapital gelöst.²
Wenn wir den fatalen Zyklus von immer neue entstehenden Initiativen und ihrem folgenden Scheitern - sei es durch Integration in das kapitalistische System oder ihre Zerschlagung - durchbrechen wollen, müssen wir eine klarere Vorstellung davon entwicklen, woran konkret solche Projekte scheitern, welches die Einfallstore für das Eindringen der Kapitalrationalität sind, wie es in den Initiativen und alternativen Organisationen des Widerstands in bestimmten Situationen zu im Sinne ihrer Autonomie „falschen“ Entscheidungen kommt. Dies erfordert neben der kategorialen eine historische Analyse. Sie muss jedoch über die Betrachtung der – sich historisch verändernden – Bedingungen für Widerstand hinausgehen und die Triebkräfte der Kämpfe, die in den Subjekten selbst liegen, ins Zentrum stellen.
Die folgenden Thesen will ich in meinem Beitrag diskutieren:
Meine erste These ist, dass es Angst, die uns an das Kapital bindet.
Das ist erklärungsbedürftig. Es muss insofern paradox erscheinen, als es gerade die tödliche Logik des Kapitals ist, die ja die eigentliche Usache der Angst ist. Ob wir uns vor der realen Bedrohung, der unser Widerstand gilt, durch Zentralismus, Hierarchie und Kontrolle (Bürokratie) oder ausgerechnet durch ein bisschen "finanzielle Sicherheit" abzusichern suchen - es ist letztlich Ausdruck des mangelnden Vertrauens dieser Angst näher zu kommen, müssen die im Wesen des Kapitals liegenden Ursachen untersucht werden.
Meine zweite These ist, dass die verdrängte, strukturell gewordene Angst die Folge eines kollketiven Traumas ist, das in Jahrhunderten der gewalttätigen Durchsetzung des Kapitals entstanden ist und immer wieder reproduziert und dabei verstärkt wird.
Die subjektive Dimension des gewaltigen historischen Prozesses der inzwischen weltweiten Durchsetzung des Kapitals in der Geschichtsschreibung der Arbeiterbewegung vielfach vernachlässigt worden. In der Regel wurde der Analyse der sich verändernden Bedingungen und Formen der Kapitalverwertung eine politische Dimension gewissermaßen aufgepfropft, in der die Subjektivität aufgehoben sein sollte. Die Subjektivität der Masse der Betroffenen blieb dabei weitgehend im Dunkel. Mir ist kein Theoretiker bekannt, der sich um die subjektiven Voraussetzungen derer,
die gekämpft und zwischenzeitlich „große Siege“ errungen haben und derer, die Opfer der Kämpfe wurden, ernsthaft gekümmert hat. Wie die „Siege“ errungen wurden und was der eigentliche Inhalt der „Siege“ war, bleibt dann genau so dunkel wie das, was mit den Menschen wirklich passiert ist.
Meine dritte These ist, dass die strukturelle Angst in der Gesellschaft in der aktuellen Phase der Auseinandersetzung eine neue Qualität erreicht hat und dass daher für eine System überschreitende Praxis die Bearbeitung der Angst – individuell wie kollektiv – heute zwingender denn je ist.
Die fortgeschrittene Verinnerlichung erscheint aus der Sicht des Kapitals als neue Qualität des Gebrauchswerts der Arbeitskraft, nämlich als genügend entwickelte Fähigkeit zur Selbststeuerung, um Hierarchien abbauen, die Detailkontrolle im Arbeitsprozess lockern und Verantwortung delegieren zu können. Sowohl die im Prozess der Verinnerlichung äußerer Anforderungen sich verschärfende Trennung vom Selbst als auch die gerade dadurch mögliche höhere Belastung verstärken die Angst und in der Konsequenz die Notwendigkeit ihrer Verdrängung. Nachhaltig zum Widerstand fähige
Strukturen erfordern die Entwicklung einer inneren Sicherheit bei den beteiligten Menschen. Das in der Arbeiterbewegung entwickelte zentrale Prinzip der Solidarität ist in diesem Sinne vor allem ein Mittel gegen die aus der gesellschaftlichen Vereinzelung erwachsende Angst und zwar nicht im Sinne der „Beruhigung“ durch weitere Verdrängung, sondern durch wachsendes Vertrauen in die eigene Kraft. Diese Solidarität gilt es weiter zu entwickeln und mit neuen Inhalten zu füllen.
Angst und Kapital
Um die Bedeutung der Subjektivität der handelnden Menschen für den gesellschaftlichen Prozess adäqut diskutieren zu können, werde ich die Aspekte der geseschaftlich-historischen Entwicklung und solche der individuellen Sozialisation und den Zusammenhang zwischen beiden Dimensionen diskutieren. Das wird nicht ausschließlich auf der Ebene der Kritik der politischen Ökonomie gelingen, sondern auch die Einbeziehung neuerer psychoanalytischer Erkenntnisse erfordern. Gehen wir also "mit Marx über Marx hinaus "(Negri 1979)!
Wie „die [ursprünglich] schöpferische Kraft seiner [lebendigen] Arbeit als dieKraft des Kapitals, als fremde Macht sich ihm [dem Arbeiter, H.H.] gegenüber etabliert“ (Marx 1865: 214), so ist die lebendige Arbeit aus der Sicht des Kapitals das Fremde, das Bedrohliche, auf das es jedoch absolut angewiesen ist. Marx’ Formulierung einige Seiten später enthält deutlich einen subjektiven Aspekt auch für die Seite des Kapitals, wenn er schreibt, dass „aus der allgemeinen Tendenz des Kapitals hervor[geht], dass es vergisst und abstrahiert von der […] notwendigen Arbeit als 37
Grenze des Tauschwerts des lebendigen Arbeitsvermögens“ und das als Ursache für die „Überproduktion: d.h. die plötzliche Erinnerung aller dieser notwendigen Momente der auf das Kapital gegründeten Produktion“ benennt; „daher allgemeine Entwertung infolge des Vergessens derselben“ (ebd.: 319, Hervorhebungen von mir, H.H.). Was von Marx hier „vergessen“ und „abstrahieren“ genannt wird, kann auch mit „verdrängen“ bezeichnet werden. Es geht hier nämlich um die strukturelle Angst des Kapitals (wer immer als Person es repräsentiert) vor seiner Aufhebung. Für ganz
wichtig halte ich den Hinweis von Negri bezogen auf den Keynesianismus, also das wirtschaftspolitische System des Fordismus, dass nämlich das System in Wirklichkeit funktioniere, „nicht weil die Arbeiterklasse immer innerhalb des Kapitals ist, sondern weil sie auch außerhalb seiner sein kann; weil sie immer von Neuem droht, sich außerhalb seiner zu stellen“ (Negri 1972: 31).
Wie das Kapital seine diesen Aussagen zu Grunde liegende Subjektivität bekommt, erschließt sich, wenn wir die beiden Begriffe Kapital und Angst systematischer in ihrem inneren Zusammenhang betrachten. Sie sind offensichtlich auf ganz unterschiedlichen analytischen Ebenen angesiedelt. Was in den handelnden Menschen vorgeht und warum sie letztlich so handeln, ist in der politisch-ökonomischen Kategorie „Kapital“ aufgehoben und bleibt gleichzeitig weitgehend verborgen. Verborgen bleibt schon, dass es immer Menschen sind, die – in ihren gesellschaftlichen Zusammenhängen und ihrem durch Sozialisation vermittelten Fühlen, Denken und Handeln – sich und ihre Umwelt und eben auch das, was wir „Kapital“ nennen, immer wieder reproduzieren und neu hervorbringen.
Wenn wir diese subjektive Ebene in die Analyse einbeziehen, steht der Begriff „Kapital“ für ein Fühlen, Denken und Handeln, das ein bestimmtes System materiell basierter Verhältnisse hervorbringt, welches sich – vermittelt wiederum durch das Fühlen, Denken und Handeln – „selbst“ zu reproduzieren scheint. Diese scheinbare „Selbstreproduktion“ hat zur Voraussetzung, dass die Menschen in ihrer gesellschaftlichen Gesamtheit auch weiterhin nach gleich bleibenden – oder doch nur kontrolliert und kontrollierbar sich verändernden – Grundsätzen fühlen, denken und handeln. Ihr so kontrolliertes – selbstkontrolliertes – Leben ist eine Folge der Selbstentfremdung der Menschen von ihren gesellschaftlichen Zusammenhängen. Das entfremdete Fühlen, Denken und Handeln ist Ausdruck davon, dass aus lebendigen sozialen Prozessen3 tendenziell „tote Dinge“ werden, verdinglicht im „Wert“. Aus der Orientierung auf den Wert folgt der für alle Beteiligten gültige Schein einer
vom Handeln der Individuen unabhängigen Herrschaft des Werts, d. h. einer Sache, über den lebendigen Prozess, die „Herrschaft [...] der toten Arbeit über die lebendige“, wie Marx es formuliert (Marx 1865: 18). An anderer Stelle charakterisiert Marx das Kapital als „verstorbene Arbeit, die sich nur vampirmäßig belebt durch die Einsaugung lebendiger Arbeit und umso mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt“ (Marx 1867: 247). Das Kapital ist hiernach etwas Totes – und doch sagen wir, das Kapital bewege sich, wir sprechen von „Kapitalbewegung“. Dieses Tote kann sich offenbar dadurch und nur dadurch bewegen, dass ihm Leben gewissermaßen „eingehaucht“ wird. Selbst der Begriff der „Einsaugung“ oder „Aussaugung“ enthält schon einen Schein von Subjektivität auf Seiten des Kapitals und ist selbst erklärungsbedürftig. Er setzt schon eine lebendige Energie voraus, über die das Kapital als bloß Totes gar nicht verfügen könnte: Nur die gesellschaftlich handelnden Menschen selbst können dem Kapital immer wieder ihre Lebensenergie zu seiner Bewegung verleihen. Wir können hier auf die Aussage Negris zurückkommen und sie umformulieren: Wenn das Kapital nur dadurch „lebt“, dass die Menschen ihm ständig ihre Lebendigkeit zuführen, dann ist es eben auch angewiesen darauf, dass die Menschen weiter über diese ihre Lebendigkeit (also aktiv, handelnd) verfügen und nicht nur passiv „überleben“ (survive). Das ist nur der Fall, solange sie noch in der Lage sind zu drohen, „sich außerhalb seiner zu stellen“.
An dieser Stelle können wir versuchen, die politisch-ökonomischen Analysekategorien und die Kategorien der Lebenswirklichkeit des gesellschaftlichen Menschen noch weiter anzunähern. Wir haben hier nämlich im Menschen selbst – in der Gesellschaft wie im Individuum – den Antagonismus vor uns: die Lebendigkeit des Menschen auf der einen Seite und zugleich das von ihm selbst ständig aktiv reproduzierte, diese Lebendigkeit zerstörende, aussaugende Kapital auf der anderen Seite. Dass es sinnvoll ist, einige Kategorien in ungewohnter Weise zu verwenden, wird sich später insbesondere bei der historischen Betrachtung der modernen Gesellschaft zeigen. So wird beispielsweise deutlich werden, dass der Begriff der „lebendigen Arbeit“ zwar als Kategorie der Kritik der politischen Ökonomie angemessen ist, wenn die funktionierende kapitalistische Produktionsweise dargestellt werden soll. Wo es dagegen um den dem Kapital innewohnenden Antagonismus geht, wähle ich zur Bezeichnung des Gegensatzes des Kapitals wie auch als dessen Quelle die „menschliche Lebendigkeit“. Denn auch das, was wir mit Marx die „lebendige Arbeit“ nennen ist ja selbst schon Produkt des Kapitals, Resultat der Ingangsetzung der Arbeitskraft. Und die Arbeitskraft ist ihrerseits als Potenz, als Arbeitsvermögen4, ein Aspekt der Lebenskraft des Menschen und wird erst im Prozess der Sozialisation durch Herausbildung eines kapitaladäquaten Gebrauchswerts zu Arbeitskraft gemacht. Die individuelle Sozialisation wird dabei umso mehr durch die Kapitalrationalität geprägt sein, je tiefer das Kapital im historischen Prozess in die Lebenswelt der Menschen eindringt.
Die Verortung des Antagonismus im Menschen selbst schließt viele gängige Interpretationen aus, die das Kapital - nachdem wir es als destruktiv entlarvt haben - als etwas uns Äußerliches zu bekämpfen trachten. Eine wichtige Erkenntnis ist diejenige, dass sich der Gebrauchswert der Arbeitskaft an dem Grad der Mitwirkung an diesem Prozess der Transformation von Lebendigkeit in Kapital bestimmt.
Kern dieses Antagonismus ist eine Spaltung. Gesellschaftlich erscheint diese Spaltung unter anderem als eine solche in Klassen. Betrachten wir das Individuum, so erscheint die Spaltung als eine Abspaltung des Ego. Das findet seinen Ausdruck im Individuum als Eigentümer seiner körperlichen, geistigen, ja psychischen Fähigkeiten. Es kann dann integrale Bestandteile seines Selbst "opfern", es kann sie gegen Teilhabe an materiellem Reichtum verkaufen. Selbstbeherrschung als "Selbstausbeutung" ist die Grundlage der Fremdbeherrschung damit Fremdausbeutung.
Die strukturelle Angst durchdringt heute die ganze Gesellschaft, auch wenn manche von uns vielleicht nie merken, dass sie von Angst geprägt sind. Die Angst äußert sich mal mehr, mal weniger, dann aber in konkreten, in "begründbar" - erscheinenden Ängsten: Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes! Angst vor Terrorismus! Angst vor Drogen! Angst vor Versagen!.... Immer Angst vor etwas!
Wir lernen die Angst von Geburt an - und was genau so wichtig ist: Wir lernen, sie zu verdrängen. Diese Angst ist nicht die Wachheit, die Aufmerksamkeit für Gefahr, die wir zum Leben brauchen, sondern eine destruktuve Angst, die uns am leben hindert. Resultate dieser Angst sind: Gehorsam, Konkurrenz, Gewalt.
Die strukturelle Angst ist keine überrhistorische anthropologische Konstante. Das zeigt ein Blick in die Geschichte der Arbeitsgesellschaft.5
Geschichte der Arbeitsgesellschaft
In der mittelalterlichen Gesellschaft im Europa des 13. und 14. Jahrhunderts gab es zumindest für die Handwerker neben den selbstverständlich arbeitsfreien Sonntagen weitere etwa einhundert Feiertage. Die tägliche Zeit und Intensität der Arbeit erstreckte sich über Jahrhunderte hinweg auf die Tagesstunden, unterbrochen von mehreren ausführlichen Mahlzeiten und Ruhepausen.6 Auf dem Lande wurde in der Haupterntezeit, „wenn es die Natur verlangte“ (Thompson 1980: 38) zwar bis zu sechzehn Stunden gearbeitet, allerdings mit sehr vielen und recht ausgiebigen Pausen, normal vier
Mahlzeiten, dazu oft noch ein oder zwei Erfrischungspausen. In den weniger arbeitsintensiven Teilen des Jahres wurde ohnehin recht unregelmäßig gearbeitet. Thompson spricht von einer vorindustriellen, „natürlichen“ Zeit bzw. von „aufgabenbezogener Zeiteinteilung“: „Wo immer die Menschen ihren Arbeitsrhythmus (angepasst an den unregelmäßigen Zyklus der Arbeitswoche und des Arbeitsjahres, H.H.) selbst bestimmen konnten, bildete sich ein Wechsel von höchster Arbeitsintensität und Müßiggang heraus“ (Ebd.: 46). Trotz der schon für das 14. Jahrhundert dokumentierten Versuche, den Arbeitstag für Lohnarbeiter durch staatliche Vorschriften7 zu verlängern und zu verstetigen, erschienen in England selbst noch während des 18. Jahrhunderts, d.h. in der Zeit vor der industriellen Revolution, viele Arbeiter nur an vier Tagen in der Woche überhaupt zur Arbeit (Marx 1867: 290).
Für die Masse der kleinbäuerlichen Weber in England, die im Dienste von Verlegern standen, war es während des 18. Jahrhunderts selbstverständlich, dass sie ihre Arbeit für die dringende Feldarbeiten solange wie nötig unterbrachen (Thompson 1987: 387). Bei aller zum Teil bitterer Armut gilt für den Beginn der industriellen Revolution, dass "das Jahr des arbeitenden Menschen immer noch aus Zyklen von harter Arbeit und schmaler Kost [bestand], unterbrochen von vielen Festtagen, an denen Essen und Trinken reichlicher vorhanden waren, Luxusartikel [...] gekauft wurden, an denen getanzt, gefreit, gefeiert, gespielt wurde" (ebd.:435).
Und noch zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts beschwerten sich Fabrikbesitzer über den "unsteten Arbeitseifer von Handwerkern". Ure zitiert ein junges Mädchen, das die Heimarbeit in bitterer Armut der Fabrikarbeit vorzog, mit dem Worten: "Es gefällt mir besser als die Fabrik, wenn ich auch nicht so viel verdiene. Wir haben zu Hause unsere Freiheit und essen unsere Mahrzeit nach unserer Bequemlichkeit, wenn sie auch gering ist" (Ure 1835:295). In dieser Zeit war der ´Blaue Montag´, ja sogar ein ´blauer Dienstag` gang und gäbe. Für Frankreich zitiert Thompson eine Quelle mit der Feststellung: "Der Sonntag gehört der Familie, der Montag den Freunden" (Thompson 1980:46). Dabei hatte der `blaue Montag` schon seit der einbrechenden Auseinandersetzung um die Anforderungen der neuen Zeit auch eine deutlich politische Dimension bekommen. Schon im 16. Jahrhundert war er für die Handwerksgesellen der freie Tag, an dem man sich traf, um kollektive Gegenwehr gegen Verstöße der Meister gegen tradierte Rechte zu organisieren (Dreßen 1982: 50f.).8
Aus der Perspektive des Beobachters aus einer industriell entwickelten Gesellschaft erscheint die „vorindustrielle Zeiteinteilung [als] verschwenderisch“ (Thompson 1980: 39), der Wechsel von Anspannung und Müßiggang erscheint als Faulheit. So machte die japanische Arbeitswelt auf europäische Beobachter selbst noch während des stürmischen Industrialisierungsprozesses um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert den Eindruck eines Landes der Faulenzer: „Der japanische Arbeiter ist kaum bereit, sich der militärischen Disziplin zu unterwerfen, die nach unseren Kriterien
eine moderne Fabrik regieren muss“ (Ein deutscher Beobachter, der sich einige Jahre in Japan aufgehalten hatte, zitiert bei Kato 1995: 3). Dieselbe Beurteilung erfuhren dann drei Jahrzehnte später die koreanischen Arbeiter durch japanische Beobachter (Cumings 1997: 123). Die Menschen sind nicht bereit, die Kapitalrationalität zu verinnerlichen, Kapitalismus bleibt etwas ihnen Äußerliches, dessen Rahmenbedingungen sie zwar ausgeliefert sind, dessen restriktivem Eindringen in ihr Fühlen und Denken sie jedoch Widerstand entgegensetzen.
Eine geraffte Zusammenfassung der Dynamik der Arbeitsgesellschaft könnte etwa folgendermaßen aussehen (vgl. Heide 1999): Die gesellschaftlichen Umwälzungen, deren Resultat die heutige Arbeitsgesellschaft ist, beginnen in der Renaissance mit den Erfahrungen der venezianischen Fernkaufleute mit den Prinzipien des Warentauschs. Indem sie die Gewinnspannen bei Seide und anderen exotischen Waren zwischen dem Orient und Europa nutzten, gelang es ihnen, ein (Handels-)Kapital zu schaffen, das ihnen so viel Macht verlieh, dass sie sich aus feudaler Abhängigkeit
befreien konnten. Reichtum und damit Herrschaft unabhängig vom Boden, ja von Natur überhaupt, das war die Botschaft, die den Keim zur Auflösung der auf Naturalbasis gegründeten Feudalgesellschaft legte. Daraus konnte sich die Ideologie der grenzenlosen Beherrschbarkeit und Ausbeutbarkeit der Natur entwickeln. Beherrschbarkeit der Natur hieß aber wesentlich Beherrschbarkeit der eigenen inneren Natur. Selbstbeherrschung wurde so erst einmal zur Kampfideologie des Bürgertums gegen die als „unbeherrscht“ erscheinende, nicht arbeitende und verschwenderisch lebende Feudalaristokratie.
In diesem Kampf nützten allerdings Selbstbeherrschung und Askese allein wenig. Das entstehende Kapital entwickelte eine soziale Dynamik, die sich nicht auf die Zirkulationssphäre einschränken ließ, sondern auf die Produktion übergriff. Das Bürgertum war angewiesen auf Sklaven und zunehmend auf „freie“ Lohnarbeiter und darauf, dass es gelang, diesen eine ausbeutbare Auffassung von Arbeitsdisziplin zu vermitteln. Die Bereitschaft zu disziplinierter Arbeit erwies sich als unverzichtbare Grundlage des Gebrauchswerts der Arbeitskraft und die Schaffung dieses notwendigen Gebrauchswerts der Arbeitskraft wurde zum entscheidenden Charakteristikum der Schaffung des Kapitalismus, d.h. der Arbeitsgesellschaft. Auf diese Weise bildete sich die moderne Form der Arbeit überhaupt erst heraus: Das zünftige Handwerk der Städte wurde unaufhaltsam durch die neuen vom Handelskapital dominierten Gewerbe zurückgedrängt, die ihre ‚Arbeitskraft’ aus den in die Städte
strömenden ursprünglich unfreien ländlichen Arbeiter oder unfrei gewordenen Bauern rekrutierten. Die Handwerksgesellen sahen sich durch diese Konkurrenz der Gewerbe auf den Status einfacher ‚Arbeiter’ herabgedrückt. Das war ein Prozess, der in Deutschland wenigstens vom 15. bis zum 17. Jahrhundert dauerte.
Die Zersetzung der alten Gesellschaft, die Auflösung der grundlegenden Lebenszusammenhänge, die zunächst von den meisten Menschen fast unbemerkt im Kampf der im Entstehen begriffenen Bourgeoisie um die Herrschaft in den oberitalienischen Städten begonnen hatte, weitete sich auch geografisch unaufhaltsam aus. Sie verlagerte ihren Schwerpunkt in der Manufakturperiode nach Nordwesteuropa, nach Flandern, Nordfrankreich und nach England, griff von den Städten aufs platte Land über und erreichte schließlich ihre erste vorläufige Vollendung mit der industriellen Revolution.
Dies ist eine Beschreibung aus großem zeitlichem und emotionalem Abstand. Um das Wesen unserer heutigen Arbeitsgesellschaft zu verstehen, ist es nötig den Versuch zu machen, diesen Abstand zu verringern. Wenn wir etwas genauer hinsehen, werden wir aufmerksam auf die ungeheure zerstörerische Gewalt dieses historischen Prozesses, die sich ebenso durch die weitere Geschichte des Kapitalismus hindurch zieht.
Die Gewalt des Umwälzungsprozesses
Das erste Statute of Labourers in England wurde schon erwähnt.9 In einem folgenden Gesetz von 1360 erhielten die Meister ausdrücklich das Recht, durch körperlichen Zwang Arbeit zum gesetzlichen Lohntarif zu erpressen" (Marx 1867:767). Das war nur der frühe Beginn der Gewalt. Es folgten Jahrhundeerte der massenhaften Vertreibung der Bauern und Häusler von Grund und Boden und die Vernichtung der handwerklcihen Heimarbeit mit der Foge, dass Massen von Entwurzelten und Erniedrigten als vogelfreie Bettler, Räuber, Vagabunden umherzogen.10 Arbeit außerhalb der bekannten sozialen Umgebung, wo die Notwendigkeit der Arbeit noch unmittelbar einsichtig gewesen war und wenn sie das nicht war, auch nicht verrichtet wurde, war nur durch Einsatz brutaler Mittel von außen zu erzwingen. Die Menschen, die die Last der Umwälzung zu tragen hatten, die das, was die Bourgeoisie „Freiheit“ nannte, allenfalls als „Freiheit von Produktionsmitteln“ wahrnehmen
konnten, versuchten zunächst weiter nach den überlieferten Prinzipien ihrer „moral economy“ (Thompson) zu leben und leisteten einen zähen Widerstand gegen die Zerstörung ihrer lebendigen sozialen Zusammenhänge.11 Hier lag der Kern des Klassenantagonismus: Mit dem Bürgertum und den arbeitenden Klassen prallten Welten aufeinander.
Einer ersten Periode offenen Terrors, der ‚Blutgesetzgebung‘, in der massenhaft Menschen geschlagen, ausgepeitscht, verstümmelt und auf grausamste Weise umgebracht wurden – zum Einen um die Unbrauchbaren schlicht zu beseitigen, zum Anderen um bei den Übrigen die Bereitschaft zur disziplinierten Arbeit zu erzwingen – folgten Perioden der pädagogischen Strafen und der Arbeits- und Industrieschulen und schließlich der Psychiatrie. Der Hintergrund war, dass wegen der Expansion der kapitalistischen Produktion die Arbeitskräfte knapp und daher wertvoller wurden.
Die Erziehung zur „zweiten Natur“ begann mit dem Zuchthaus, das in London im Jahre 1555 eröffnet und in dem öffentliche Hinrichtungen noch als Teil eines Erziehungsprozesses eingesetzt wurden, als dessen Ziel ausdrücklich die Selbstregulierung genannt wurde (Dreßen 1982: 20 ff). Noch im selben Jahrhundert entstanden unzählige weitere Zuchthäuser in vielen Städten auch auf dem Kontinent.12
Im Produktionsprozess selbst galt es vor Allem, den Sinn für Pünktlichkeit durchzusetzen. Die Geschichte der „Werkglocken“ reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück (Schor 1991: 50 f.) und schon für das Jahr 1700 konstatiert Thompson Betriebe, in denen die Disziplin mit Hilfe von Kontrollkarten, Aufsehern, Denunzianten, Fabrikstrafen und einer Fabrikordnung „so dick wie ein Gesetzbuch“ durchgesetzt werden sollten (Thompson 1980: 51).
Im England vor der industriellen Revolution erwarben sich viele freireligiöse Vereinigungen, besonders jedoch die Methodisten, das Wohlwollen von Unternehmern wie auch der Behörden, indem sie durch Pamphlete und Predigten sowie durch die Einrichtung von Armen- und Sonntagsschulen für die Unterschichtkinder den Armen Pünktlichkeit und Disziplin näherzubringen suchten. Es ging ihnen dabei übrigens nicht nur um die Fabrikarbeit, sondern auch um die damals noch verbreitete Heimarbeit und damit auch unmittelbar um das häusliche und soziale Leben, ja auch um die Feierstunden, den Sonntag usw. (Thompson 1987: 434). „Die Schüler werden an frühes Aufstehen und Pünktlichkeit gewöhnt“ und als Begründung dafür, dass Kinder von über vier Jahren für 10 Stunden Fabrikarbeit und 2 Stunden Schulunterricht in die Arbeitshäuser gesteckt werden sollten, hieß es 1770 an anderer Stelle: „Es ist sehr nützlich, wenn sie auf irgendeine Art beschäftigt werden, wenigstens 12 Stunden am Tag, ob sie damit nun ihren Unterhalt verdienen oder nicht; denn wir hoffen, dass sich die auf diese Weise heranwachsende Generation so sehr an ständige Beschäftigung gewöhnt, dass sie diese zuletzt als angenehm und unterhaltend empfindet“ (zitiert bei Thompson 1980: 53).
Im laufe dieses "pädagogischen Jahrhunderts" verbreiteten sich von England aus Arbeitsschulen oder Industrieschulen, meist im Zusammenhang mit Waisen- und Armemhäusern über ganz West- und Mitteleuropa (Dreßen 1982: 178f.). Nach Ure ist das entscheidende Problem der Fabrik, „Menschen dazu zu bringen, auf ihre unstete Arbeitsweise zu verzichten und sich mit der unveränderlichen Regelmäßigkeit dieses komplizierten Automaten (eben der Fabrik, H.H.) zu identifizieren“. Er hielt es „fast für unmöglich, Personen, welche bereits über die Pubertät hinaus sind, [...] zu nützlichen
Fabrikarbeitern abzurichten“ (Ure 1835: 14). Die Erziehung musste also bei den Kindern, je früher, desto besser, beginnen (vgl. Thompson 1987: 391). Dass es bei den Erziehungsmaßnahmen um mehr ging als um bloße „Gewöhnung“, deutet sich in den Schriften des besonders fundamentalistischen Predigers Wesley an: „Brich ihren Willen beizeiten. Beginne mit diesem Werk, bevor sie allein laufen können [...] Lehre das Kind, wenn es ein Jahr alt ist, die Rute zu fürchten und leise zu weinen; von diesem Alter an lehre es zu tun, was man von ihm verlangt, und wenn du es zehnmal hintereinander schlagen musst“ (Wesley, zitiert nach Thompson 1987: 404).13
Ganz wichtig ist, zu verstehen, dass allein die Zerstörung der unmittelbaren sozialen Zusammenhänge, der Familie und der Dorfgemeinschaft katastrophale Folgen für die psychische und physische Gesundheit der Arbeiter hatte. Aus Interviews, die in Japan mit betroffenen Frauen Anfang des 20. Jahrhunderts nach der dortigen ersten Industrialisierungsphase geführt wurden, geht hervor, dass schlimmer als Not und Armut die Erniedrigung gewesen war und der Verlust der Gemeinschaft. An die Stelle traten dann endlose Arbeitszeiten, Nachtschichten, niedrige Löhne und individuelle
Konkurrenz (NIRA-Report 1985, zitiert bei Kato 1995).
Nach diesen Überlegungen ist der folgenden Einschätzung von E. P. Thompson zuzustimmen: „Durch alle diese Methoden – Arbeitsteilung und Arbeitsüberwachung, Bußen, Glocken- und Uhrzeichen, Geldanreize, Predigten und Erziehungsmaßnahmen, Abschaffung von Jahrmärkten und Volksbelustigungen – wurden neue Arbeitsgewohnheiten und eine neue Zeitdisziplin ausgebildet“ (Thompson 1980: 58). Die Aufzählung all dieser Details ist überwältigend; sie erklärt aber nicht wirklich die durchgreifende und nachhaltige Wirkung auf das Leben der ganzen Gesellschaft. Die Schwierigkeit einer Erklärung deutet sich schon darin an, dass die Prediger des 18. Jahrhunderts ja noch eine schlichte „Gewöhnung“ unterstellten. Thompson stellt dagegen explizit die Frage, wie der ursprünglich äußere Zwang internalisiert wurde, wie es also zur inneren Akzeptanz kam (ebd.: 59), ohne sie freilich zu beantworten.
Dreßen wiederum wendet sich gegen eine „zu soziologische“ Sichtweise14, er selbst betont dagegen die pädagogische Dimension des historischen Prozesses. Das liefert auch bei ihm einen außerordentlich anschaulichen und sehr plausiblen Beitrag zum Verständnis der Geschichte der Arbeitsgesellschaft (Dreßen 1982: 9). Wie aber genau die realisierte Pädagogik und die reale gesellschaftliche Gewalt im Allgemeinen auf die Menschen (übrigens Opfer wie Täter) wirken, bleibt auch bei Dreßen undeutlich. An zwei Stellen berührt Thompson die m.E. für die Interpretation entscheidende Dimension: An einer Stelle spricht er von den „psychischen Konsequenzen der Konterrevolution“ (Thompson 1987: 404), und er erwägt noch konkreter im Zusammenhang mit Gedanken über die Hintergründe der Ausbreitung des Methodismus unter den Armen zwischen 1790 und 1830 als Ursache einen „Chiliasmus der Verzweiflung“ (ebd.: 418). Thompson stellt dann für diese Periode, die gleichzeitig auch eine Periode der politischen Radikalisierung war, die These auf, „dass die Erweckungsbewegung sich gerade dann durchsetzte, wenn ‚politische‘ oder weltliche
Bestrebungen eine Niederlage erlitten“ (ebd.: 419). Wenn die Niederlagen so gewaltig sind, dass den Menschen nur noch die Flucht in eine Heilserwartung zu bleiben scheint, dann macht das deutlich, wie tief die Gewalt in die Psyche der Menschen und damit in ihr Denken und Handeln eingegriffen hat. Das immer erneute Aufbäumen gegen die Unterdrückung wird auf geradezu makabre Weise deutlich, wenn man die Entwicklung als „wellenförmig“ (ebd.) erkennt, bis der Radikalismus schließlich mit der Vollendung der industriellen Revolution endgültig unterdrückt und die Armen ruhig gestellt worden waren.
Zur Zeit der industriellen Revolution gab es dann zwar äußerst harte und organisierte Kämpfe, die meisten jedoch bereits auf der Ebene des neuen Paradigmas der industriellen Arbeit und das heißt der Disziplin und der Identifikation mit der Arbeit. Thompson formuliert in Bezug auf die gewaltsame Durchsetzung der Arbeitszeit: „In der ersten Phase finden wir lediglich Widerstand. Danach aber, sobald sich die neue Zeitdisziplin durchgesetzt hat, beginnen die Arbeiter zu kämpfen und zwar nicht gegen, sondern um die Zeit“ (Thompson 1980: 54). Es sind schließlich die Arbeiter, die darauf bestehen, dass die Zeit gemessen wird und dass die Uhr für alle sichtbar in der Werkhalle aufgehängt wird und nicht in der Schublade des Werkmeisters eingeschlossen bleibt. Ein wesentlicher Aspekt ist auch die Durchsetzung der Disziplin und Selbstdisziplin innerhalb der Arbeiterorganisationen selbst, der entscheidend zur „Fähigkeit zum kontinuierlichen organisatorischen Engagement“ beitrug und sie schlagkräftiger machte (Thompson 1987: 424).15
Die Spätfolge von Jahrhunderten der Gewalt war schließlich nicht nur eine disziplinierte Arbeiterklasse, sondern weit darüber hinaus eine insgesamt disziplinierte Gesellschaft, die sich auf Arbeit gründet, die die Notwendigkeit der Arbeit nicht mehr hinterfragt.16 Im Jahre 1848 taucht in der europäischen Arbeiterbewegung erstmals der Slogan vom „Recht auf Arbeit“ auf.17
Mit der Taylorisierung um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert zielte das Kapital durch eine „wissenschaftliche“ Rationalisierung der Arbeitsabläufe auf die Enteignung noch vorhandener Gestaltungsspielräume der Arbeiter in Bezug auf die Ausführung der Arbeit. Die darauf aufbauende fordistische Form mit Hilfe der Maschinisierung des Taylorismus in der Gestalt des Fließbands stieß auf einen unerwartet starken individuellen und kollektiven anarcho-syndikalistischen Widerstand, der erst mit dem von Angst diktierten Schachzug, einen „Fünfdollartag“ zu versprechen, gebrochen werden konnte – und zwar grundlegend (Bologna 1989: 7). Dieses, zusammen mit der Überwachung (bei Ford durch die Sozialpolitische Abteilung), formte ein kollektives Belegschaftsbewusstsein endgültig auf der Basis des Fabriksystems. Der Kampf um Gewerkschaften und schließlich der Kampf durch sich zentralistisch und kapitaladäquat entwickelnde Gewerkschaften zahlte sich für die Arbeiter nach und nach in „Errungenschaften“ aus, die ganz im Sinne des Kapitals wiederum die Identifikation mit dem System fördern und die ehedem extrem störende Fluktuation stark einschränken.
Was auf die hier kurz skizzierte Weise auf der Ebene der einzelnen Fabrik begann, verbreitete sich wegen seines Erfolgs aus der Sicht des Kapitals, vermittelt über die Konkurrenz, über das nationale Territorium (hier der Vereinigten Staaten), verlor damit auf nationaler Ebene für das Einzelkapital nach und nach seinen Konkurrenzvorteil und wirkte damit als Druck auf eine Reorganisation des Weltsystems im mittleren Drittel des 20. Jahrhunderts. Erst auf dieser Ebene kann von „Fordismus“ als einer „Akkumulationsweise“ oder „Regulationsweise“ gesprochen werden.
Es kann festgehalten werden, dass die Entschärfung des Klassenantagonismus, nämlich seine Transformation in einen Verteilungskampf, erst nach der grundlegenden Zerstörung der alten sozialen Beziehungen und Lebensweisen möglich wurde, als der Kampf der Arbeiter um die Anerkennung als bürgerliche Subjekte, der an die Stelle des Kampfes um die Menschenwürde getreten war, sich auf die Grundlage des verallgemeinerten Arbeitsparadigmas („Recht auf Arbeit“) verlagert hatte.
Dass der Fordismus eine neue Stufe der Aggressivität und Gewalt repräsentiert, dringt gewöhnlich nicht in das vom „Klassenkompromiss“ bestimmte Bewusstsein vor, weil sich die Gewalt gegen ein „Außen“ richtet. Dieses bezeichnet zunächst einmal den Gegensatz zu Allem und Allen, die nicht Teilnehmer am Konsens waren. Ökonomisch setzte der Klassenkompromiss eine weltweite Wertumverteilung zu Gunsten der fordistischen Länder voraus, die nur mit einer planmäßigen Großmachtpolitik, d. h. mit Gewalt durchzusetzen war. Das zwanzigste Jahrhundert wurde so mit zwei Weltkriegen, mit Faschismus und Holocaust, mit Stalinismus, mit Hungerkatastrophen und der Erfindung des low intensity warfare zu einem Jahrhundert neuer bis dahin nicht gekannter Gewalt.
Die „Krise des Fordismus“ ist eine neue Antwort des Kapitals auf eine neue Stärke der Arbeitermacht. Einen Aspekt dieser Stärke erfährt das Kapital durch die prinzipielle Grenzenlosigkeit der Forderungen im Verteilungskampf, was insbesondere angesichts des ständig gefährdeten Machtgefüges im Weltsystem ein „roll back“ erfordert. Andererseits ist mit der wachsenden Eingliederung in das System für die Arbeiter die Diskrepanz zwischen der Freiheit in der Welt des Konsums und der Unfreiheit im fordistischen Fabriksystem von Kommando und Kontrolle zunehmend spürbar eworden. Dass dieses so gespürt wird, hängt auch damit zusammen, dass mit der weiter gewachsenen Verinnerlichung der Kontrolle die Fähigkeit zur Selbststeuerung weit genug entwickelt ist, so dass jede Kontrolle von oben als obsolet und einengend erscheinen muss.12
Während von daher der neoliberale Angriff für das Kapital zur Notwendigkeit wird, hat sich also inzwischen auch in den Individuen mit ihrem weiter entwickelten Bewusstsein die Möglichkeit zu einer Auflösung der Fabrik entwickelt. So erweist sich auch die Ära des Fordismus wie die früheren Phasen der Geschichte des Kapitals wieder auch als – erfolgreicher – „Erziehungsprozess“.
Die Arbeiter haben es schwer, zu diesem Angriff des Kapitals ein adäquates Bewusstsein zu entwickeln, da das Neue ihnen in der Form einer Verselbstständigungstendenz eben auch als neue Freiheit, eine „neue Autonomie“ (vgl. z. B. Peters 2002) erscheint. Und zwar unabhängig davon, ob sie in eine reale neue Selbstständigkeit in ihren Entscheidungen formell frei gesetzt werden oder ob ihre Entscheidungsspielräume in einem formell weiter unselbstständigen Arbeitsverhältnis erweitert werden.
Kollektives Trauma
Die oben kurz referierten eindrucksvollen historischen Studien von Thompson und Dreßen machen das ungeheuere Ausmaß von Gewalt deutlich, das mit der Durchsetzung der Arbeitsgesellschaft verbunden war. Dennoch bleibt etwas Entscheidendes dabei ungeklärt. Das schließliche Ergebnis dieses Prozesses der Gewalt im Leben ganzer Generationen von Menschen mag „plausibel“ sein; auf welche Weise dieser kollektive, unentrinnbare Prozess auf die Menschen wirkt, insbesondere dass er offenbar mindestens zu einer Akzeptanz der Macht des Kapitals führen kann, bleibt bei ihnen jedoch letztlich im Dunkeln.19
Ähnlich unbefriedigend bleibt auch ein noch so detailliertes Studium der weiteren Geschichte des Kapitalismus als einer Geschichte der kämpfenden Klassen mit Siegen und auch mit Niederlagen. Das gilt ebenso für die obigen kurzen Bemerkungen zur fordistischen und postfordistischen Entwicklung. Fraglich erscheint darüber hinaus, ob angesichts der Verstrickung in das tödliche Paradigma des Kapitals letztlich überhaupt von „Siegen“ die Rede sein kann.
Zu einem tieferen Verständnis der scheinbaren „Selbstreproduktion“ des Kapitals und der zunehmenden Verstrickung der Menschen in dessen Paradigma können m. E. die Ergebnisse der modernen Traumaforschung helfen. Wir wissen heute, dass schwere traumatisierende Aggression von den Betroffenen oft nur durch die identifikatorische Annahme der Unterwerfung unter die überwältigende Macht psychisch bewältigt werden kann. Über die Wirkung traumatisierender Gewalteinwirkung auf die unmittelbar Betroffenen wie auf die Nachkommen hat insbesondere Dina Wardi eindrucksvolle Forschungsergebnisse vorgelegt, die sie aus der Aufarbeitung der persönlichen Geschichten von Überlebenden des Holocaust und deren Nachkommen gewonnen hat (Wardi 1997: 63 u. passim).
Die neueren Forschungen beziehen sich auf das von Ferenczi 1932 in die psychoanalytische Theorie eingeführte Konzept „Identifikation mit dem Aggressor“ (Ferenczi 1933; Gruen 2000). Dieses Konzept wurde ursprünglich zur Erklärung der häufig gemachten Beobachtung entwickelt, dass Kinder als Opfer von sexuellem Missbrauch, physischer Misshandlung und schließlich auch psychischem Terror durch die Eltern oder andere Erwachsene, von denen sie abhängig sind, diesen Terror verinnerlichen und sich selbst mit dem Aggressor identifizieren. Die Macht des Angreifers ist in einem solchen Fall so überwältigend, dass an Auflehnung oder auch nur Ausweichen nicht einmal zu denken ist: „Die Kinder fühlen sich körperlich und moralisch hilflos, ihre Persönlichkeit ist noch zu wenig konsolidiert, um auch nur in Gedanken protestieren zu können“ (Ferenczi 1933: 308). In der unmittelbar lebensbedrohlich erscheinenden Situation ist die Identifikation mit dem Aggressor damit eine Überlebensstrategie (ebd.: 155). Auf diese Weise gelingt es, die nicht zu bewältigende Angst geradezu in Geborgenheit umkippen zu lassen (Gruen 1997: 96ff.). Was in einer konkreten Einzelsituation das Überleben sichern hilft, kann als Strategie gegen fortdauernde Aggression jedoch zu einem Verhaltensmuster werden, mit dem sich der betreffende Mensch durch Ich-Zerstörung tendenziell zum lebenslangen Opfer macht. Das Verhaltensmuster verhindert nachhaltig wirkliche Lebendigkeit, indem es alle Alternativen systematisch ausblendet. Durch die Identifikation findet
eine Abtrennung vom Selbst bzw. ein „Verrat am Selbst“ (Gruen 1986) statt; Judith Herman spricht auch vom „zerstörten Selbst“ (Herman 1993: 79 ff.). Die Introjektion der fremden Identität führt dazu, dass die fremden Bedürfnisse schließlich für die ureigensten gehalten werden. Eine kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen wird so verhindert. Das permanente Niederhalten der Angst vor dem Sich-regen des Selbst ist mit einem hohen Verbrauch an Lebensenergie verbunden. Grundsätzlich identische Folgen können auch bei Traumata von Erwachsenen eintreten. 20 Bei ihnen ist allerdings zunächst mit einer „konsolidierten Persönlichkeit“ zu rechnen. Ein eigenes Wertesystem und nicht mehr primär die vorbehaltlose Liebe von Seiten bestimmter Bezugspersonen sichern normalerweise die individuelle Identität. Wenn die erlittene und erlebte Gewalt allerdings so überwältigend ist, dass Gegenwehr wie Weglaufen gänzlich ausgeschlossen erscheinen, dann kann auch der erwachsene Mensch oft nur noch mit einer „Bewusstseinsveränderung“ (ebd.: 65 ff.) reagieren. Wolfgang Schmidbauer hat dafür den aus der somatischen Medizin bekannten Begriff der „Zentralisation“ auf die psychischen Vorgänge übertragen (Schmidbauer 1998, passim). Durch Zentralisation aller verfügbaren psychischen Kräfte auf das unmittelbare Überleben tritt psychisch, aber auch mit physischen Entsprechungen, eine „Erstarrung“ oder „Konstriktion“ (Herman 1993: 65 ff.) ein. Jeder Prozess von Lebendigkeit, d. h. jedes unkontrollierte, unkontrollierbare Gefühl wird dann angstvoll und als bedrohlich erlebt und als Folge des Versuchs der Kontrolle möglicherweise lebenslang verdrängt. „Posttraumatisch führt diese Zentralisation zu seelischen Verhärtungen – Abwehrstrukturen, die verhindern sollen, dass die schmerzhaften Erlebnisse das Ich erneut überschwemmen. Verdrängung, Schweigen, gereizt missmutige Haltung und allgemeiner sozialer Rückzug kennzeichnen den depressiven Pol dieser Abwehr, Idealisierung von Krieg und Kampf, hemmungslose Selbstüberschätzung, Rücksichtslosigkeit und Größenphantasie den manischen Pol“ (Schmidbauer 1998: 71). Aus Angst vor den eigenen Gefühlen werden die „natürlichen Trauerreaktionen so lange bagatellisiert und unterdrückt [...], bis sie [die depressiv Erkrankten] durch diese Schonungslosigkeit erschöpft und ausgebrannt sind“ (ebd.: 72).21 Zentral ist hier die Angst, obgleich sie als Folge der Verdrängung eben nicht bewusst erlebt wird. Es entsteht letztlich eine „Angst vor
der Angst“, ein Teufelskreis, der immer größere Lebensenergien in der Verdrängung und Kontrolle bindet.
Bei dem Versuch, die hier kurz referierten Wirkungen auf traumatische Erfahrungen aus modernen Kriegen oder anderen massenahft wirkenden Ereignissen oder aus der Gewalt und dem Elend des Industrialisierungsprozesses zu übertragen, tritt hinsichtlich der beobachteten Identifikation mit dem Aggressor ein wichtiger Aspekt hinzu: An die Stelle des persönlichen und persönlich identifizierbaren Aggressors oder zusätzlich zu ihm tritt dann eine anonyme überwältigende Macht, deren „Logik“ für das Opfer überhaupt nicht zu durchschauen ist. Das ursprüngliche Werte- und Normensystem kann gänzlich außer Kraft gesetzt werden, der folgende Zustand ist der der Haltlosigkeit und Trostlosigkeit. Das wirkt noch extrem verschärfend auf das posttraumatische Syndrom (ebd.: 84). Die „Identifikation mit dem Aggressor“ wird dann eher zu einer Identifikation mit dem System, das als siegreich aus der Situation hervorgegangen ist, und eine Introjektion von dessen Paradigma.Oder, in Anlehnung an Schmidbauer: Durch die Identifikation mit dem anonymen Aggressor verliert das Opfer seine ursprüngliche Identität, die sich gewissermaßen als „wertlos erwiesen“ hat, „gewinnt aber als Lohn der Unterwerfung die Illusion der Allmacht, die dem Eintauchen in eine totale Institution entspringt“ (ebd.: 89). Was nach so tiefen Niederlagen zurückbleibt, ist die Angst vor der eigenen Schwäche und Unzulänglichkeit und damit die existenziell empfundene Notwendigkeit, diese zu verdrängen. Damit müssen aber auch das eigene Fühlen, Denken und Handeln verdrängt werden, die der Grund für die Niederlage waren. Dies führt kollektiv (gesellschaftlich) oft zur Verachtung und Aggressivität gegen die (schwächere) Minderheit derjenigen, die zu recht oder zu unrecht mit jenem Fühlen, Denken und Handeln in Verbindung gebracht wird. Dazu gehört die, teils offene, teils verdeckte Aggression gegen Kinder, Alte, Behinderte usw. und nicht zuletzt rassistische Aggression.
Diese Trennung vom Selbst, von den eigenen unerträglichen Gefühlen22, entspricht gesellschaftlich der Trennung (oder Entfremdung) von der eigenen Geschichte, es kommt zu einer kollektiven Verdrängung. Dieses ist nicht nur Folge der Herausbildung des Kapitalismus, sondern eine wesentliche Voraussetzung für sein Funktionieren. Ist der Glaube an eine Alternative grundlegend zerstört, so entwickeln die Individuen nach Marx ein Interesse an der Beteiligung an der kapitalistischen Gesellschaft in dem Maße, wie ihnen das Sich-Einlassen auf die Konkurrenz als Voraussetzung ihres Überlebens erscheint. D. h., sie entwickeln dann ein „Privatinteresse“, das „nur innerhalb der von der Gesellschaft gesetzten Bedingungen und den von ihr gegebenen Mitteln erreicht werden kann; also an die Reproduktion dieser Bedingungen und Mittel gebunden ist“ (Marx 1939: 74). Dies entspricht der oben erwähnten Ausblendung aller Alternativen aus dem Bewusstsein. Der tatsächlich
immer wieder auftauchende Widerspruch der lebendigen Menschen zum System reduziert sich dann darauf, entweder zwanghaft nach Reformen innerhalb des Systems zu suchen oder aber sich in eine blinde Aggressivität zu flüchten.
Erklärlich wäre auf die beschriebene Weise die tiefe Formung einer Gesellschaft, wenn eine ganze Generation unmittelbar von einer traumatischen Erfahrung betroffen wurde. Aber selbst wenn wir die Wahrscheinlichkeit einer lebenslangen Auswirkung der beschriebenen introjektiven Identifikation annehmen, so würde damit letztlich nur ein zeitlich begrenzter Effekt erklärbar, der mit der ursprünglich betroffenen Generation langsam aussterben müsste. Und in der Tat gehen die meisten Theorien der Moderne davon aus, dass das Stadium des Frühinustrialismus mit dem modernen Sozialstaat endgültig überwunden sei.
Da aber „posttraumatische Störungen“, wie sie in der offiziellen klinischen Terminologie heißen, wesentlich Kommunikationsstörungen sind, müssen sie sich auch auf die nachfolgenden Generationen auswirken. Da weiterhin gilt, dass Sozialisation ein kumulativer Prozess ist, in dem alle Einwirkungen bleibende „Eindrücke“ hinterlassen – ob bewusst oder unbewusst –, ist die frühkindliche Entwicklungsphase von zentraler Bedeutung. In der Kindheit entstandene verfestigte Angst kann so zum bestimmenden Moment eines ganzen Lebens werden. Und diese tief sitzende Angst ist es, die weitergegeben wird. Auf diese Weise können „die Eltern [...] zum Trauma für ihre Kinder“ werden (Schmidbauer 1998: 288f.; vgl. aber auch 131f.).
Die Tradierung der Traumata erfolgt jedoch keineswegs nur je individuell von den Eltern oder den gesellschaftlichen Institutionen wie Schule usw. direkt auf die Kinder.Es ist nahe liegend anzunehmen, dass die verbreitete Bereitschaft zur Gewalt genau so eine Spätfolge von Jahrhunderten der Traumatisierung ist, wie die scheinbare Normalität der Anpassung an die Fabrikarbeit und die anderen Zumutungen der Arbeitsgesellschaft. Der schon erwähnte millionenfache Ausbruch dieser latenten Gewalt in diesem gewissermaßen „langen“ 20. Jahrhundert ist seinerseits Glied in einer Kette von Krieg und Terror, die sowohl kollektiv, als auch bis hinein in die einzelnen Familien wirkt.23 Dieses kann durchaus als indirekte Tradierung interpretiert werden. Auf diese Weise werden die Traumatisierung und die posttraumatische Angst immer wieder erneuert, und das ist es, was in den Individuen und mit ihnen in den Organisationen und der Gesellschaft insgesamt die Voraussetzungen reproduziert, die dann als „Selbstreproduktion“ des Kapitals im zwanzigsten und offenbar auch im einundzwanzigsten Jahrhundert erscheinen.
Was als Traumatisierung tradiert wird, tritt bei den Individuen in verschiedenen Ausprägungen von Sucht, einer psychosomatischen Krankheit, auf. Nach den obigen Ausführungen ist offensichtlich, dass Krankheit hier nicht eine Abweichung von „Normalität“ bezeichnet, da der Zustand der Sucht die Gesellschaft insgesamt charakterisiert (Heide 2003: 49; vgl. auch Niebling 1997). Unter Sucht ist ein Zustand zu verstehen, der als Zwang, Drang oder Getriebensein erlebt wird bei der Suche, den Schmerz der Realität nicht zu spüren (Wilson Schaef 1998: 183).24 So ist Sucht als Mangel an Autonomie beschreibbar. Ausführlicher bin ich auf das Problem der Sucht, insbesondere der Arbeitssucht, an anderer Stelle eingegangen (vgl. z. B. Heide 2003). Wichtig ist im hier diskutierten Zusammenhang, dass es offenbar langfristig zu einer Verschiebung zwischen verschiedenen Suchtausprägungen gekommen ist. Von besonderer Bedeutung für das Verständnis postfordistischer Entwicklung ist dabei die Unterscheidung zwischen „neurosebestimmten“ und „depressionsbestimmten“ Suchtformen. Neurosen sind charakteristische Folgen der Verinnerlichung des Zwangs, etwas im Grunde gegen seinen Willen zu tun, und korrespondieren mit der Entwicklung des Kapitalismus bis hin zur fordistischen Phase. In den letzten Jahrzehnten dominieren mehr und mehr die depressiven Erkrankungen (Ehrenberg 2004) und damit die Leistungssüchte bis hin zur Arbeitssucht (Heide 2003).Das ist unschwer im Zusammenhang mit der (Selbst-)Anforderung zur Selbststeuerung und Allverantwortlichkeit zu interpretieren, die die postfordistische Phase nicht nur im Arbeitsprozess, sondern im gesamten gesellschaftlichen Prozess charakterisieren.25 Die Folgen werden sichtbar im „Burn-out“ und im „erschöpften Selbst“ (Ehrenberg 2004).26 Sie sind Ausdruck für das notwendige Scheitern des postmodernen Menschen an der Grenzenlosigkeit der selbst gesetzten Ansprüche an sich selbst als Folge der Verinnerlichung des (Kapital-)Prinzips der Grenzenlosigkeit.
Schlussfolgerungen
Nach den hier vorgetragenen Überlegungen kann unmittelbar aus der „Subjektivierung der Arbeit“ keine neue Autonomie der arbeitenden Individuen hergeleitet werden, die ein irgendwie geartetes neues Emanzipationspotenzial darstellen könnte. Wenn es nämlich Angst ist, die uns an das Kapital bindet, liegt genau darin das entscheidende Autonomiedefizit. Dann ist das Durchbrechen der Spirale der Angst der entscheidende erste Schritt, den die neuen sozialen Bewegungen bewusst angehen müssen. Dieser zentrale Aspekt ist in der Geschichte der Arbeiterbewegung und anderer sozialer Bewegungen immer wieder vernachlässigt worden. Das ist mitverantwortlich für Bürokratisierung auf der einen und Zersplitterung auf der anderen Seite. Es ist ebenso mitverantwortlich dafür, dass Widerstand oft erst dann beginnt und nur solange vorhält, wie die Wut, die ja eine Reaktion auf etwas als ungerecht Empfundenes ist, größer ist als die Angst. Psychoanalytisch argumentiert: die Wut wird – ähnlich wie ein Suchtmittel – vor die Angst geschoben, so dass diese nicht mehr gespürt wird. Daher: Je größer die tatsächliche Angst, desto riesiger muss die Wut sein, um den Kampf zur Veränderung aufnehmen zu können. Die Alternative scheint dann nur der Rückfall in die Lethargie zu sein. Daraus kann dann leicht der Schluss gezogen werden, dass in einer solchen Lage der Dinge für jeden neuen Anlauf zum Kampf, Streik usw. die Wut nur wieder stark genug geschürt werden, dass das „Ungerechte“ an den zu bekämpfenden Verhältnissen klar gemacht werden müsse, um aus der ansonsten herrschenden Lethargie heraus zu kommen. Zu erkennen, dass Wut eine Reaktion auf Ungerechtigkeit ist, ist ganz entscheidend. Wenn es nämlich dabei bleibt, d.h. diese Wut und die hinter ihr stehende Angst nicht bearbeitet werden, dann kann dabei nur zweierlei herauskommen: entweder „Sieg“, der im aggressiven Sinn zerstörerisch ist, oder „Niederlage“ mit Frustration und Depression und erneuter und weiterer Anpassung, was im Opfersinn zerstörerisch ist. Und das wäre genau das Resultat, das uns wegen seiner Unerträglichkeit weiter an das Kapital bindet. Hiermit ist schon logisch die Richtung des Kampfes auf Beseitigung von Ungerechtigkeit innerhalb des Systems angelegt.
In der aktuellen Entwicklungsphase mit ihrem Prozess der „Verselbstständigung“ nimmt der psychische Druck nicht nur am Arbeitsplatz, sondern in der Gesellschaft insgesamt zu. Ein wachsender Teil der Menschen wird faktisch ausgegrenzt.27 Angst verstärkt sich sichtbar. Gleichzeitig wächst – jenseits von Analysen – das Gefühl, dass die Zeit reif ist für einen qualitativen Sprung im Widerstand.
Im historischen Prozess hat sich der Begriff der Solidarität, der noch aus den alten korporativistischen Zusammenhängen stammte, grundlegend gewandelt. Hatte die alte Bedeutung noch schlicht „Stärke durch innere Einigkeit“ (von lat. solidus, fest, stark) ausgedrückt, die durch eine streng auf die Mitglieder beschränkte Gegenseitigkeit und gleichzeitig Abgrenzung gegen „außen“ charakterisiert war, so wurde sie in der Moderne erweitert. Im christlichen (und philanthropischen) Sinn konnte Solidarität fast zum Synonym für Barmherzigkeit (Selbstlosigkeit) werden. Je mehr sich in der Arbeiterbewegung ein die kapitalistische Gesellschaft transzendierendes Bewusstsein entwickelte, desto klarer wurde der Begriff auf die umfassende Zusammengehörigkeit aller Erniedrigten ausgeweitet und das frühere „Außen“ bezog sich dann eigentlich nur auf die Unterdrücker, konnte aber bei Bedarf auch alle diejenigen betreffen, die auf Grund ihrer Klassenzugehörigkeit als „konservativ“ und „fortschrittsfeindlich“ eingeschätzt wurden. Letzteres bedeutet eine Kopplung an einen strukturalistisch aufgefassten Interessenbegriff, wie er zu den Interessen vertretenden bürokratischen Großorganisationen im Fordismus (und im Realsozialismus) passt.
Heute steht ein neuer Schritt der Weiterentwicklung des Begriffs der Solidarität an. Er fällt mit dem Übergang vom Interesse zum Bedürfnis zusammen. Solange sich die Menschen auf die Wahrnehmung ihres Interesses glaubten beschränken zu können, haben sie auf den Kontakt zu ihren Gefühlen verzichtet, konnten sie ihr erschöpftes Selbst nicht spüren. Dies lässt sich nicht fortsetzen. Der Kontakt zu den Gefühlen und damit zu den Bedürfnissen ist lebensnotwendig. Um die eigenen Bedürfnisse kennen zu lernen, ist eine Offenheit erforderlich, sich mit der tief verdrängten
Angst auseinanderzusetzen. Dies ist ein Lernprozess, in dessen Verlauf sich die Gründe für Angst real verringern.
Es gilt, eine neue Art von kooperativer Organisation zu entwickeln, die Offenheit ermöglicht und die gleichzeitig selbst ständig erneuertes Produkt dieser Offenheit ist. Diese Offenheit drückt sich dann in den Programmen aus, in den internen und öffentlichen Diskussionen, in der Ausformung der Organisation selbst und eben konstitutiv im Umgang miteinander. Nicht zufällig kennzeichnet viele der neuen widerständigen Bewegungen, dass sie mit dem ausdrücklichen Formulieren der eigenen Angst beginnen…
ANMERKUNGEN
- Hier sei beispielhaft auf das NCI-Netzwerk bei Siemens München (vgl. den Beitrag von Inken Wanzek in diesem Band) und die Erfahrungen bei IBM Düsseldorf (Glißmann 2000) hingewiesen.
- Nicht in der Oktoberrevolution und auch nicht bei der Erkämpfung der Errungenschaften der fordistischen Ära.
- Soziale Beziehungen sind wesentlich „Lebendigkeit“, also Prozess.
- Vgl. zum dialektischen Verhältnis zwischen Arbeitsvermögen und Arbeitskraft die Arbeiten von Sabine Pfeiffer, z. B. Pfeiffer 2004.
- Dieser Blick kann hier schon aus Platzgründen nur sehr begrenzt sein. Die frühe Phase bis zur industriellen Revolution halte ich für die Entstehung der strukturellen Angst für entscheidend
und werde sie etwas ausführlicher skizzieren. Ich stütze mich dabei für Europa vor allem auf Thompson (für England) und Dreßen (für Preußen). Für die späteren Phasen werde ich mich
weitgehend darauf beschränken, auf die Tradierung und die fortlaufende Erneuerung und Verstärkung der Angst wie auch auf ihre Veränderungen hinzuweisen. - Diese Aussage gilt unmittelbar für die handwerkenden Männer, zudem gibt es keine klare Trennung zwischen Arbeit und Muße, insbesondere in den Feierabendstunden erledigten die Menschen
kleinere, durchaus „produktive“ Tätigkeiten. - In England gab es das erste königliche „Statute of Labourers“ im Jahre 1349 (Marx 1867: 287).
- Ganz Ähnliches gilt für andere vor- oder frühkapitalistische Gesellschaften. In Bezug auf Japan vgl. Kato 1995.
- Vgl. oben, Anmerkung 6.
- Das ist der Prozess, der später distanziert-wissenschaftlich mit „Trennung von den Produktionsmitteln“ umschrieben wird.
- Es gab vor allem den allgegenwärtigen passiven Widerstand und es gab periodische Revolten, oft in der Form von Hungerrevolten zum Beispiel mit der Forderung nach einem „gerechten“
Brotpreis, aber es gab auch Aufstände gegen die Maschinen als die „Kriegsmittel des Kapitals“ (Marx) und einzelne verhasste Unternehmer. Früh wurden aber auch transzendierende Utopien
von Freiheit und Gleichheit von – meist qualifizierten – Arbeitern aufgegriffen. Da liegt auch der Ursprung für die Weiterentwicklung des urspünglich korporatistischen Begriffs der Solidarität.
Dass es dabei in jedem Fall um eine andere Art zu leben ging, wird oft nicht deutlich genug gesehen, selbst nicht von Max Weber, wie in folgendem Zitat deutlich wird: „Überall wo der
moderne Kapitalismus sein Werk der Steigerung der ‚Produktivität‘ der menschlichen Arbeit durch Steigerung ihrer Intensität begann, stieß er auf den unendlich zähen Widerstand [...]
präkapitalistischer wirtschaftlicher Arbeit“ (Weber 1968: 45). - Nach 1604 wurde in Bremen ein Zuchthaus nach Amsterdamer Vorbild gebaut, das seinerseits auf das Londoner Vorbild zurückgeht.
- Drakonische schicksalhafte Strafen finden sich auch in der im 19. Jahrhundert aufkommenden deutschen Kinderliteratur, z. B. im berühmten „Struwwelpeter“ des Psychiaters Heinrich Hoffmann,
das 1845 erschien. - in Auseinandersetzung mit Foucault.
- Das war einerseits ein Erfolg methodistischer Einflüsse, hat andererseits auch mit der Orientierung an dem Vorbild der ‚ehrbaren‘ Handwerksgilden zu tun (Thompson, 1987: 447ff).
- Spätestens von da an kann von einer „Arbeitsgesellschaft“ gesprochen werden.
- Das ist der Tatbestand, den Paul Lafargue zu seiner polemischen Forderung nach einem „Recht auf Faulheit“ veranlasste (Lafargue 1891).
- Auf das neue Bewusstsein wiesen schon vor dem ernsthaften Beginn der Konzepte von „Delegation von Verantwortung“ usw. viele Beispiele für die Übernahme der Produktion in Eigenregie
der Arbeiter hin. - Kurz hat zwar eindringlich auf die große und in dir übrigen Literatur selten gewürdigte Bedeutung der Entwicklung der Feuerwaffen und der damit nötig und möglich gewordenen neuen Strategien der Kriegführung für die Arbeitsgesellschaft hingewiesen (vgl. Kurz 1999: 15ff.).Es muss davon ausgegangen werden, dass gerade daraus kollektive Traumatisierungen folgten.
Darauf und auf deren Weiterwirken als einen entscheidenden Aspekt der Durchsetzung der Arbeitsgesellschaft hat aber auch Kurz nicht hingewiesen. - Erst in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts unter dem Eindruck der Erkenntnisse über massenhafte Traumafolgen bei amerikanischen Veteranen des Vietnamkriegs sind
die seelischen Folgen von Traumatisierungen bei Erwachsenen „offiziell“ durch Aufnahme in die Handbücher Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) und des International
Statistical Classification of Deseases and Related Health Problems (ICD) der Weltgesundheitsorganisation unter der Bezeichnung „Post Traumatic Stress Disorder“ aufgenommen worden (Schmidbauer 1998: 97). - Schmidbauer führt dieses als Hypothese, als ein „in der therapeutischen Praxis bewährtes Modell der Depression“ ein. Vgl. auch den Hinweis von Dina Wardi auf die Bedeutung des „Zustand(s) unverarbeiteter Trauer“ (Wardi 1987: 105).
- Das impliziert die Trennung von den eigenen Gefühlen überhaupt.
- Vgl. zu der mit einer Verspätung von fast sechzig Jahren begonnenen Aufarbeitung der Traumata der Generation derer, die die Jahre des zweiten Weltkriegs in Deutschland als Kinder erlebt haben, die empirisch und theoretisch wertvolle bahnbrechende Arbeit von Sabine Bode (Bode 2005).
- Eine etwas distanziertere Definition: Sucht ist eine Art und Weise, mit der man entweder durch die Einnahme von Stoffen oder über ein Verhalten, das körpereigene Drogen produziert, sein
Fühlen und schließlich sein Denken und Handeln manipuliert. - Amendt fragt rhetorisch, wieviel Stress und Drogen der Mensch aushalten kann (Amendt 2000).
- Inzwischen hat das Suchtproblem ein solches Ausmaß angenommen, dass sich auch die etablierte Forschung ihm nicht mehr entzieht. Es geht ihr jedoch nicht um eine gesellschaftskritische Aufarbeitung, sondern um den kürzesten Weg zu einer Therapie, die das normale Funktionierender Betroffenen wieder herstellt. Als Hintergründe für Internetsucht werden in einer neuen Studie immerhin „Angststörungen, depressive Episoden, Substanzabhängigkeiten und posttraumatische Belastungsstörung“ erkannt. Wieso diese offenbar gehäuft auftreten, wird aber nicht untersucht. Vgl. Kratzer 2006.
- Die traditionellen Interessenorganisationen stehen dem in der Regel hilflos gegenüber. Betriebsräte handeln Lohnverzicht und Mehrarbeit gegen eine vorläufige Erhaltung eines Teils der Arbeitsplätze aus und wissen eine Mehrheit derer, die sie gewählt haben, hinter sich. Diese reagiert oft verbittert, stimmt aber mangels Alternativen meist zu. Auch die immer wieder aufflammenden öffentlichen Demonstrationen sind bei aller Vielfalt und Kreativität im Einzelnen insgesamt eher pessimistisch geprägt.
Literatur
AMENDT, GÜNTHER (2000): No Drugs – No Future. Über psychoaktive Substanzen
im postfordistischen Zeitalter. Manuskript eines Essays, gesendet im NDR4 am
21.05.2000.
BODE, SABINE (2005): Die vergessene Generation. Die Kriegskinder brechen ihr
Schweigen. Stuttgart.
BOLOGNA, SERGIO (1989): Zur Analyse der Modernisierungsprozesse. Einführung
in die Lektüre von Antonio Gramscis ‚Americanismo e Fordismo’. Arbeitspapiere-
Atti-Proceedings, Nr. 5. Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte des 20.
Jahrhunderts. Hamburg.
DREßEN, WOLFGANG (1982): Die pädagogische Maschine. Zur Geschichte des industrialisierten
Bewusstseins in Preußen/Deutschland. Frankfurt am Main usw.
EHRENBERG, ALAIN (2004): Das erschöpfte Selbst. Frankfurt am Main.
FERENCZI, SÁNDOR (1933): Sprachverwirrung zwischen dem Erwachsenen und dem
Kind. Die Sprache der Zärtlichkeit und der Leidenschaft. In: Schriften zur Psychoanalyse.
Vol II.
GLIßMANN, WILFRIED (2000): Interview in „Metall“ – Zeitschrift der IG Metall,
Heft 1/2000.
GRUEN, ARNO (1986): Der Verrat am Selbst. Die Autonomie bei Mann und Frau.
HEIDE, HOLGER (1999): Gedanken über Solidarität. In: Gedanken über Menschenrechte
und Solidarität. Arbeitspapiere zur sozialökonomischen Ost-Asien-Forschung.
Nr. 7. SEARI. Universität Bremen.
HEIDE, HOLGER (2003): Arbeitssucht in der Arbeitsgesellschaft. Die Abschaffung
der Muße und ihre Wiederaneignung. In: Heide, Holger (Hg.): Massenphänomen
Arbeitssucht. Historische Hintergründe und aktuelle Entwicklung einer
neuen Volkskrankheit. Bremen.
HERMAN, JUDITH L. (1993): Die Narben der Gewalt. Traumatische Erfahrungen
verstehen und überwinden. München.
HORKHEIMER, MAX, UND ADORNO, THEODOR W. (1969 [1944]): Dialektik der Aufklärung.
Philosophische Fragmente. Frankfurt am Main.
KATO, TETSURO (1995): Workaholism: It’s not in the Blood. In: Look Japan, Feb.
1995. Tokyo. [http://www.ff.lij4u.or.jp/~katote/Home.html]
KRATZER, SILVIA (2006): Pathologische Internetnutzung. Lengerich.
KRUMBHOLTZ, ROBERT (1898): Die Gewerbe der Stadt Münster bis zum Jahre 1661.
Publikationen aus den K. Preußischen Staatsarchiven. Leipzig.
KURZ, ROBERT (1999): Die Diktatur der abstrakten Zeit. Arbeit als Verhaltensstörung
der Moderne. In: Kurz, Robert, et al. (Hg.): Feierabend! Elf Attacken gegen
die Arbeit. Hamburg.
LAFARGUE, PAUL (2000[1891]): Das Recht auf Faulheit. Berlin.
MARX, KARL (1939[1858]): Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie. Rohentwurf.
Frankfurt am Main/Wien.
MARX, KARL (1973[1867]): Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Bd. 1.
Berlin.
MARX, KARL (1969[ca. 1865]): Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses.
Archiv sozialistischer Literatur 17. Frankfurt am Main.
NEGRI, ANTONIO (1968): La teoria capitalistica dello stato. In: Contropiano. Wieder abgedruckt in: Operai e stato. Milano 1972. Hier zitiert nach der deutschen 55
Ausgabe: Die kapitalistische Theorie des Staates: John M. Keynes. In: Zyklus
und Krise bei Marx. Berlin.
NEGRI, ANTONIO (1979): Marx oltre Marx. Quaderno di lavoro sui Grundrisse.
Milano.
NIEBLING, GOTTFRIED G. (1997): Die Suchtgesellschaft. Zur Soziogenese eines Phänomens
‚individueller’ Pathologie. Aachen; Mainz.
PETERS, KLAUS (2002): Individuelle Autonomie und die Reorganisation von Unternehmen.
In: Jahrbuch Arbeit und Technik 2001/2002.
PFEIFFER, SABINE (2004): Ein? Zwei? – Viele! … und noch mehr Arbeitsvermögen!
Ein arbeitssoziologisches Plädoyer für die Reanimation der Kategorie des Arbeitsvermögens
als Bedingung einer kritikfähigen Analyse von (informatisierter)
Arbeit.
SCHMIDBAUER, WOLFGANG (1998): ‚Ich wusste nie, was mit Vater ist‘. Das Trauma
des Krieges. Reinbek.
SCHOR, JULIET (1991): The Overworked American. The Unexpected Decline of Leisure.
New York.
THOMPSON, EDWARD P. (1980): Zeit, Arbeitsdisziplin und Industriekapitalismus. In:
Plebejische Kultur und moralische Ökonomie. Aufsätze zur englischen Sozialgeschichte
des 18. und 19. Jahrhunderts. Frankfurt am Main.
THOMPSON, EDWARD P. (1987): Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse.
Frankfurt am Main.
URE, ANDREW (1835): Das Fabrikwesen in wissenschaftlicher, moralischer und
commercieller Hinsicht. Leipzig.
WARDI, DINA (1997): Siegel der Erinnerung. Das Trauma des Holocaust. Psychotherapie
mit Kindern von Überlebenden. Stuttgart.
WEBER, MAX (1968 [1905]): Die protestantische Ethik und der ‚Geist‘ des Kapitalismus.
Tübingen.
WILSON SCHAEF, ANNE (1998): Living in Process. New York.